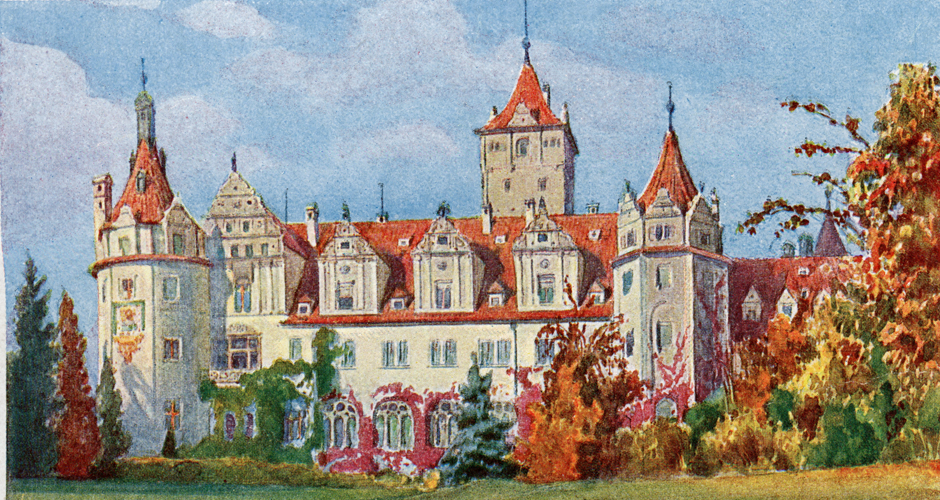Ehrenbürger der Gemeinde Steinach
Sie haben sich um unsere Gemeinde besonders verdient gemacht

Karl Mühlbauer
Bürgermeister der Gemeinde Steinach (1995 – 2020)
Am 30. Oktober 2025 wurde Karl Mühlbauer das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.
Damit würdigte der Gemeinderat Steinach sein jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement und sein unermüdliches Wirken für die Gemeinde Steinach — sowohl während seiner Mandatszeit von 1984 bis 1995 als Gemeinderat, als auch in seiner 25-jährigen Amtszeit von 1995 bis 2020 als Erster Bürgermeister.

Ludwig Dotzler
Bischöflich-Geistlicher Rat
Pfarrer in Steinach (1965 – 1987)
Am 17. April 1985 wurde Ludwig Dotzler in Anerkennung seiner Verdienste um die Belange und das Wohl der Gemeinde das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.
Er verstarb am 26. Dezember 2003 in Amberg im Alter von 83 Jahren.

Johann Gnogler
Bischöflich-Geistlicher Rat
Pfarrer (1947 – 1965), anschließend Schlossbenefiziat (1965 – 1987) in Steinach
Am 10. Februar 1965 erhielt Johann Gnogler das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für sein verdienstvolles Wirken.
Er starb am 14. Januar 1987 im Alter von 98 Jahren und wurde auf dem Steinacher Friedhof beigesetzt.

Ludwig Niggl
Landesökonomierat und Bürgermeister
Am 3. Januar 1960 wurde Ludwig Niggl das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.
Als Nestor der „Grünlandbewegung“ machte er die Steinacher Grünlandsaatzucht weltweit bekannt und erhielt dafür diese hohe Auszeichnung.
Er verstarb am 25. Dezember 1971 im Alter von 96 Jahren in Steinach und wurde dort auf dem Friedhof beerdigt.

Dr. Max von Schmieder
Schlossgutsbesitzer
Am 28. März 1958 erhielt Dr. Max von Schmieder das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für seine Verdienste um Steinach und die örtlichen Vereine.
Er starb am 23. Januar 1999 im Alter von 90 Jahren.

Josef Aschenbrenner
Pfarrer in Steinach (1935 – 1947)
Anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums am 15. Juni 1957 wurde ihm das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.
Er starb am 4. Juni 1964 im Alter von 83 Jahren und fand auf dem Steinacher Friedhof seine letzte Ruhestätte.

Stefan Müllner
Pfarrer in Steinach (1928 – 1933)
Am 7. Februar 1933 erhielt er das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für sein segensreiches Wirken in der Pfarrgemeinde.

Josef Schlicht
Schlossbenefiziat in Steinach (1871 – 1917)
Am 12. November 1911 erhielt Josef Schlicht das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach.
Über Jahrzehnte war er eng mit Steinach verbunden und beschäftigte sich intensiv mit der Geschichte des Ortes.
Im Jahr 1908 veröffentlichte er das Buch „Die Geschichte von Steinach“.
Er verstarb am 18. April 1917 im Alter von 85 Jahren in Steinach und wurde dort auf dem Friedhof beigesetzt.
Eine Gedenktafel in der Kirche erinnert an ihn.
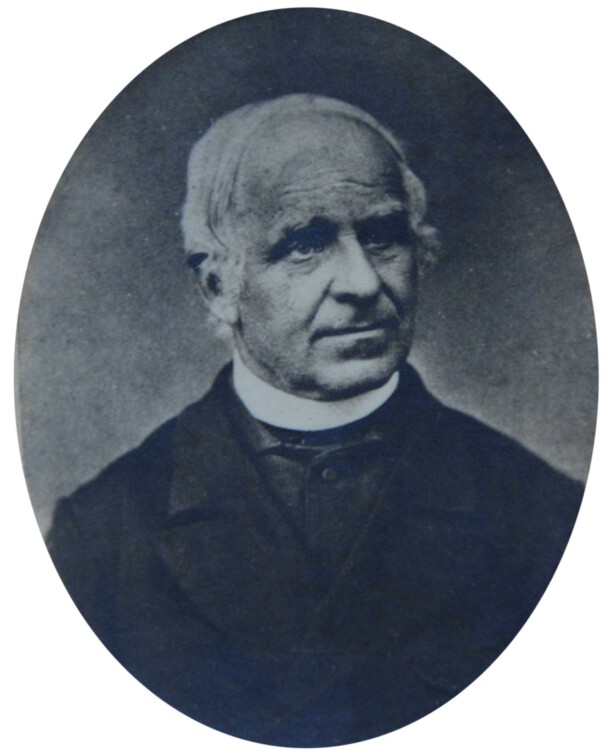
Franz Seraph Gratzl
Pfarrer in Steinach (1874 – 1887)
Am 24. Dezember 1888 erhielt er das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für seine Verdienste um die Gemeinde und die Innenerneuerung der Pfarrkirche.
Er starb am 12. August 1897 im Alter von 79 Jahren in Steinach und wurde ebenfalls dort beigesetzt.
Ehrenbürger der ehemaligen Gemeinde Münster
Sebastian Andorfer
Am 6. Juni 1951 wurde Sebastian Andorfer aus Straubing für seine besonderen Verdienste um die Gemeinde Münster die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Johann Baptist Schlosser
Pfarrer in Münster (1928 – 1951)
Anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums wurde ihm im Jahr 1950 die Ehrenbürgerschaft verliehen.
Er verstarb am 5. Oktober 1956 im Alter von 81 Jahren in Münster und wurde auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt.
Johann Prem
Pfarrer in Münster (1917 – 1927)
Am 18. September 1927 erhielt er die Ehrenbürgerschaft für sein verdienstvolles Wirken.
Johann Baptist Dietl
Pfarrer in Münster (1884 – 1897)
Am 7. August 1892 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft für seine Verdienste um die Gemeinde verliehen.
Er starb am 22. Mai 1897 im Alter von 73 Jahren in Münster und wurde dort beigesetzt.
Ehrenbürger der ehemaligen Gemeinde Agendorf
Peter Landstorfer
Bürgermeister der Gemeinde Agendorf (1947 – 1960)
Am 5. Mai 1960 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft für seine Verdienste um die Gemeinde verliehen.
Quelle:
Agsteiner Hans, Eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, 1996
Bilder:
Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Hochzeit mit dem Tode
von Max Peinkofer
Als der Heimatdichter Max Peinkofer zu Besuch auf einem Gut im Gäuboden weilte, entdeckte er dort ein besonderes kostbares Buch. Es war ein prächtiger Lederband, geschmackvoll mit Gold verziert, mit bestem blütenweißem Papier. Es handelte sich um die Schweizer Erstausgabe eines großen Prosawerks von Johann Wolfgang von Goethe. In dem Buch fiel Peinkofer eine Widmung auf, geschrieben in fast männlicher, eigenwilliger, vornehmer Handschrift. Sie lautete: "Gott allein ist treu. Treu ist auch der Tod, das letzte große Lebensgeschenk Gottes". Dann folgte die Zuneignung des Buches an Fräulein Maria X. mit Ort und Tag des Eintrags sowie dem Namen der Spenderin: "Ihre getreue Benigna von H."
Peinkofer erzählt weiter: Die paar Worte ergriffen mich und schienen ein dunkles Verhängnis zu verraten. Was mir nun die Gastgeberin erzählte, bewies, dass meine Vermutung berechtigt war. Das Goethebuch ist ein Geschenk der Spenderin an Fräulein Maria, die sich beide gleichzeitig im Kriege in der Gäubodenstadt als Rotkreuzschwestern hatten ausbilden lassen und sich dabei freundschaftlich nahegekommen waren. Damals betreute Baronesse Benigna von H. auch einen Offizier aus altem bayerischem Adel, den Grafen Stephan von Guteneck. Sie lernten sich lieben, verlobten sich noch im Lazarett und verbrachten einen verheißungsvollen Brautstand, zumal die Heilung des Schwerverwundeten unerwartet rasche Fortschritte machte. Auch hier mag sich die Liebe als bester Arzt erwiesen haben. Der Graf erhielt nach seiner Entlassung aus dem Lazarett längeren Urlaub in Aussicht gestellt, kehrte In die Hauptstadt zurück und besuchte dann von dort aus öfter seine Braut auf Schloss Hohenaich, dem Sitz ihres Geschlechtes. Der Tag der Hochzeit, die man ganz still und schlicht zu feiern vorhatte, wurde festgesetzt.
Das sollte die erste Hochzeit auf diesem Schlosse werden. Es gehörte zu einem alten Edelsitz mit ansehnlichem Grundbesitz und einem schlichten Herrenhaus aus früheren Jahrhunderten, das, unbequem und räumlich ungenügend, den Wohnansprüchen des Vaters Benignens nicht mehr genügt hatte. Deshalb hatte er einige Jahre vor dem ersten Weltkrieg auf einer künstlich geschaffenen Waldblöße unweit des alten Sitzes ein sehr stattliches neues Schloss errichten lassen. Die ersten Künstler der Hauptstadt hatten für den Neubau und seine Ausstattung die Entwürfe geliefert. Nach mehrjähriger Bauzeit stand das Schloss hoch über der Donau in den Vorbergen des Bayerischen Waldes, dessen Wälder überragend und wahrhaft fürstlich in Ansehen und Einrichtung. Seine mächtigen Flügel, hohen roten Dächer und weißen Türme leuchteten hinein in das friedlich wogende Waldgebirge, hinunter auf den breiten glänzenden Strom, hinweg über die fruchtschweren Ackerbreiten der Kornkammer und bis zu den Toren der türmerreichen alten Herzogsstadt. Mancher von denen, die einst etwa von Regensburg bis Passau fuhren, mögen jenes waldversteckte große Schloss von der Ferne aus bewundert haben, in dem sich die Geschichte vollendet, die zu erzählen wir etwas umständlich begonnen haben.
Benigna von Hohenaich hatte alles Notwendige für die nahe bevorstehende Trauung vorbereitet und auch dabei die Ruhe und stille Behutsamkeit an den Tag gelegt, die dem edlen und feinen Menschenkinde angeboren waren. Es war etwa drei Wochen vor dem angesetzten Hochzeitstag, als Graf Stephan einen vereinbarten Besuch auf Hohenaich in letzter Stunde telegraphisch kurz absagte. Es vergingen dann Tage, bis dann ein Brief von ihm eintraf der die Absage der Reise mit einem unbedeutenden Vorwand zu entschuldigen suchte und nichts mehr von der gewohnten Herzlichkeit und früher so oft beteuerten Sehnsucht des Schreibers verriet. Die weiteren Briefe des Grafen wurden deutlich kühler seltener und knapper. Benigna, die alles, was eigene Freuden und Nöte anbelangte, mit sich selber abzumachen pflegte, blieb wohl auch jetzt ruhigen und gefassten Wesens, verhehlte es sich aber nicht, dass der kurze Traum vom großen Glück ihres Lebens ein Ende gefunden habe. Von Tag zu Tag erwartete sie die Botschaft, die ihr volle Gewissheit darüber geben würde. Bis dann bald ein eingeschriebener Brief des Grafen ankam darin er Benigna das Jawort mit der Begründung zurückgab, dass er sich ihrer nicht würdig fühle und sie niemals glücklich mit ihm würde. Er bat seine ehemalige Braut, sie möge ihm verzeihen und nicht fluchen, auch wenn er ihr noch mitzuteilen habe, dass er sich in den nächsten Tagen mit Komtesse R. verloben würde. Seine Trauung mit ihr würde bald stattfinden, weil er gegen Erwarten bereits in der allernächsten Zeit wieder an die Front gehen müsse. Der Brief schloss mit Höflichkeitsformeln, Empfehlungen und Wünschen für eine Benignens würdige glückliche Zukunft.
Die Baronesse las den Brief, las ihn ein zweites und drittes Mal. Dann ging sie, es war an einem strahlenden Vormittag des August, in den sommerstillen weiten Wald, der das neue Schloss Hohenaich umgab, und ging dort, von niemand gesehen, lange auf und ab, grad und aufrecht wie sonst, ganz hingegeben ihren Gedanken und wohl erwogenen Entschlüssen, die, wie sie sich zurechtgelegt hatte, nunmehr notwendig geworden seien. Hierauf begab sich Benigna wieder zum Schloss zurück. Seit längerem gab es auf Hohenaich nur mehr stille Mahlzeiten im kleinste Kreise. Freunde und Bekannte, die früher gern die noble Gastfreundschaft des Hauses, seine Anregungen und seine Stille genossen hatten, waren durch den Krieg in alle Winde zerstreut worden oder dem Ungeist der Zeit zum Opfer gefallen. Der seit Jahren verwitwete Schlossherr konnte sich auch nicht mehr wie einstens Gästen widmen. Das große Gut, das er bedeutend vermehrt, zu Ansehen gebracht und einem Musterbetrieb gemacht hatte, nahm ihn jetzt umso mehr in Anspruch, als es überall an erfahrenen Dienstleuten fehlte und die strengen Ablieferungspflichten erhöhte Arbeit forderten. Dazu lastete auch auf seinem Herzen die brennende Sorge um die Geschehnisse jener gnadenlosen Zeit. Als man zu Mittag gespeist hatte, der Baron und seine Tochter, trug der alte Diener wie gewohnt den Mokka im Rauchzimmer auf. Der Baron, dem es längst kein Geheimnis hatte bleiben können, dass zwischen seinem Kinde und dem Grafen Stephan eine Entfremdung eingetreten war, brachte die Rede auf die immer näher rückende Hochzeit, für die der zweite September vorgesehen war. Benigna zog den letzten Brief des Grafen hervor und überreichte ihn mit einer Miene, die nichts von innerer Bewegung verriet, ihrem Vater. Als er das Schreiben zu lesen anfing, erbleichte er; als er es zu Ende gelesen hatte, schlug er unter einem jähen Wort mit der Faust so heftig auf das Tischchen, dass ein Teil des Meißner Porzellans auf den Boden fiel und in Scherben zersplitterte. Benigna versuchte, den Empörten mit der Versicherung zu beruhigen, dass sie die Auflösung ihrer Verlobung mit Fassung zu ertragen wisse und mit sich in allem völlig ins Reine gekommen sei.
Benigna, die sich für einige Zeit vom Lazarettdienst hatte beurlauben lassen, um die Vorbereitungen für die vermeintliche Trauung zu treffen, verbrachte nunmehr die meisten Stunden auf ihren Zimmern, eifrig beschäftigt mit Schreiben und allerhand Zurichtungen. Früher ritt sie gerne mit dem Vater in den Forst und auf die Felder, hielt sie sich, die Blumenfreundin, häufig in den Gärten und Gewächshäusern auf. Auch besuchte sie oft bedürftige Leute des nahen Pfarrdorfes, das sich an das Alte Schloss Hohenaich schloss. Nur noch selten ging sie jetzt ins Dorf hinüber, aber reicher denn sonst beladen mit erwünschten, seit langem selten gewordenen Dingen. Der zweite September, mild und voll reichen frühherbstlichen Glanzes, brach an und goss seinen Schimmer über Schloss und Höhen und Wälder, Benigna hatte mit ihrem Vater gefrühstückt. Von keiner Seite wurde auch nur ein Wort davon gesprochen, dass an diesem Tage die Trauung Benignens hätte stattfinden sollen. Es war einst hierfür die zehnte Stunde vorgesehen. Benigna redete von den Tagen der Kindheit, dem Guten und Schönen, das die verstorbene Mutter und der Vater in ihr sorgenfreies Leben getragen haben. Sie sagte, es wäre kein Wort imstande, auszudrücken, was sie ihren Eltern und der Heimat an Dank schuldete. Der Freiherr, sichtlich von düsteren Gedanken beherrscht, bemühte sich, ein Benehmen an den Tag zu legen, als hätte auch er sich hinwegzutrösten vermocht über das Schicksal seines Kindes und diesen gedankenschweren Tag. Benigna trat ruhig und aufrecht wie immer an das hohe Bogenfenster des Zimmers und blieb lange dort stehen.
Das Fräulein schien sich nicht sattsehen zu wollen an dem vertrauten Bild der Heimat mit den geruhsamen Wäldern, den sanft wallenden Höhen, dem breiten glitzernden Strom, der durch die fruchtgesegnete Ebene fließt, aus der, von zitternden Lichtern umwogt, die Türme jener Stadt aufsteigen, in der Benigna ihr reines Herz verschenkt hatte für immer und ewig, wie sie gehofft hatte; verschenkt an einen, der dieses Geschenkes bald überdrüssig geworden war. Benigna beschaute die Türme der Stadt und sah den Strom, in dem sich einst das Schicksal der schönen Baderstochter aus Augsburg, die ein Herzog geliebt und zur Gemahlin erhoben hatte, das düstere Schicksal der Agnes Bernauer, erfüllt hatte. Ihre Liebe lohnte der Tod der treue Tod, getreu wie der, der ihn zur rechten Zeit schickt, damit aller Schmerz und alles Ungemach für immer ende in Frieden. Mit einem Male wandte sich Benigna um. Taumelte sie ein wenig, als sie dann, rasch entschlossen auf ihren sinnierenden Vater zutrat, dem sie nun einen Kuss auf die Stirne gab? Dann drückte sie ihm wie jeden Morgen, die Hände; heute aber länger und inniger wie sonst. "Auf Wiedersehen, Papa! Auf schönes, frohes Wiedersehen, bester Papa! Und tausend Dank für alle Liebe und alles Gute!" sagte sie noch und verließ dann rasch das Frühstückszimmer. Der Baron blieb, ein wenig fassungslos und erschrocken, in dem nun unheimlich stillen Zimmer zurück. Vom hohen Turm des Schlosses schlug es die neunte Stunde.
Für diese Zeit hatte Benigna ihre Zofe Gretel in das Ankleidezimmer bestellt. Gretel erschien und erschrak, als sie auf dem großen Ankleidetisch Brautkleid, Brautschmuck und Brautschleier ihrer Herrin sowie Myrtenzweige bereitliegen sah. Die Baronesse sagte: "Gretel, kleide mich nun an Ich bin heute Braut. Aber frag nicht lang!"
Gretel, die seit Jahren in Diensten des Hauses stand und wegen ihrer Tüchtigkeit, Treue und Verschwiegenheit das Vertrauen ihrer jungen Herrin genoss, rang zittern die Hände: "Um Himmelswillen, gnädigste Baronesse! Was soll das bedeuten? Wo ist denn der Herr Graf, der Bräutigam? Man hat ja gar nichts mehr von der Hochzeit gehört und den Herrn Grafen schon so lange nicht mehr gesehen!" Die Baronesse beschwichtigte die Erschrockene:
"Frag nicht lang, Gretel, hab ich gesagt! Es ist alles, wirklich alles in Ordnung. Der Bräutigam kommt bestimmt sehr bald, glaub mir nur!"
Die Zofe zögerte erst, dann begann sie, der Herrin das Brautgewand anzulegen, mit Tränen in den Augen und zitternden Händen. Es wurde kein Wort gesprochen. Das schlichte weiße Brautkleid saß gut; das Brautgeschmeide wurde umgehängt, der Schleier aufgesteckt, dann das Kleid mit Myrten verziert. Als das alles geschehen war, nahm Benigna den Brautstrauß aus der Vase und stellte sich vor der Zofe auf. Groß und schön stand sie da, aber mit ernstem Antlitz. Sie sagte: "Ich danke dir, treue Seele! Nun ist alles so, wie es sein muss. - Jetzt sag mir noch, wie ich dir gefalle!"
Gretel sank in die Knie, küsste unter Schluchzen die Hand ihrer Herrin und stöhnte: "Oh, freilich eine wunderschöne Braut, gnädigste Baronesse! Ganz wie im Märchen. Aber ach, alles das ist so traurig, so entsetzlich traurig!"
"Du gute Närrin!" lächelte Benigna. "Du sollst nicht weinen, wenn mich nun bald der beste und treueste Bräutigam holt. - Lass dir aber erst noch danken für alle Lieb und Treu, gute Gretel!" Und sie umarmte die Weinende, küsste sie und drückte ihr die Hände. Dann nahm sie die Blumen wieder, ging auf die Türe ihres Wohn gemaches zu, winkte der Fassungslosen
und rief ihr zu: "Lebe wohl, Gretel, behüt dich Gott! Auf Wiedersehn!" Dann betrat sie feierlich ihr Zimmer.
Etwas vorher fuhr ein kleiner bedeckter Lastwagen an Schloss Hohenaich vor und hielt vor dem großen Eingangstor. Der Fahrer steigt ab und zieht die Glocke. Der Pförtner erscheint und fragt nach dem Begehr des Fuhrmannes. Der derbe Mann zündet sich gemächlich eine Zigarette an, dann antwortet er: "Also, das wär ich jetzt mit dem Sarg, der heut für Ihr Schloss bestellt worden ist. Ein dürftiger Sarg, sag ich Ihnen, ganz armselig und billig, schön weiß wie ihn Jungfrauen brauchen. - Freilich, traurig sowas, wenn man es bedenkt. Aber da kann man nichts machen!"
Der Pförtner erschrickt. Ein völlig unerwartet angefahrener Sarg erregt Schauer, auch wenn man nicht weiß, für wen er bestimmt ist. - Aber gottlob, im Schloss ist alles gesund und erst recht niemand gestorben. Also, denkt der Pförtner bei sich, bräuchte ich eigentlich gar nicht erschrecken. Er wendet sich an den Fuhrmann: "Das muss ein Irrtum sein, lieber Mann! Sie haben sich verfahren. Bei uns ist niemand gestorben. Fahren Sie nur gleich wieder weiter! Eine solche Fracht sieht man nicht gern." Der Fuhrmann entrüstet sich: "Nein, Herr! Sie irren
sich! Der Sarg ist vom Herrn Hobelsberger in der Stadt, der wo das große Sarglager hat. Er ist vorgestern bestellt worden. Das muss stimmen. Und schon bezahlt. Von einem feinen jungen Fräulein. Für mich, den Fahrer, hat sie dem Sargfabrikanten ein schönes Trinkgeld dagelassen. Gleich zwanzig Markl, sag ich Ihnen. Das muss stimmen. Und mit einer Totentruhe macht man keine Dummheiten. Sie gehört für das Schloss Hohenaich, und dabei bleibt es."
Der Pförtner, erst recht betroffen, weiß nicht, was er mit dem Sarg anfangen soll: "Ists wies mag, es kann nur ein Irrtum sein. Fahren Sie bitte den Sarg zurück, auch wenn er bezahlt ist! - Jeden Augenblick kann der Herr Baron kommen. Der gnädige Herr braucht diesen vermaledeiten Sarg nicht zu sehen."
Er erinnert sich, dass der Herr in den letzten Tagen eine sehr ernste Stimmung gezeigt hatte. Der Fahrer aber gibt nicht nach, geht an den Wagen, hebt allein seine Fracht herunter und stellt sie ganz nahe an das hohe Wappen bemalte Tor. Da steht nun der einfache Sarg mit einem kleinen silbernen Kruzifix oben. Der Pförtner schiebt den Sarg verärgert zurück, der Fahrer flucht und schiebt ihn wieder an das Tor. Im gleichen Augenblick schlägt es vom hohen Schlossturm die zehnte Stunde. Der Fahrer nickt zufrieden: "Bin ich nicht pünktlich? Punkt zehn Uhr, hat es geheißen, muss der Sarg vor dem Schlosseingang stehen. Und er steht da und bleibt da! Das muss stimmen. - So, und jetzt gehts wieder heimzu! - Mein Beileid, habe die Ehre!" Und schon will er den Wagen besteigen, um die Rückfahrt anzutreten.
Da öffnet sich die kleine Pforte neben dem Tor. Heraus tritt der Schlossherr, begleitet von seinem Schäferhund. Er will Nachschau halten auf den Feldern. Der Baron erbebt, als er den Sarg bemerkt, und fragt, sichtlich unangenehm berührt, was es damit für ein Bewenden habe. Der Pförtner deutet auf den Fahrer, der noch einmal umständlich von seinem Auftrag berichtet und immer wieder beteuert: "Das muss stimmen."
Der Baron fasst sich an den Schläfen und ordnet kurz an, den Sarg in das Turmgewölbe zu verbringen. Seine Stimme ist unsicher, seine Haltung nicht mehr so aufrecht wie sonst. Er begibt sich zurück in das Schloss und geht langsamen, müden Schrittes die breite Marmortreppe hinauf, die zu den Gemächern seiner Tochter führt, Er geht zögernd den langen gewölbten Flur entlang, in dem die kostbaren alten Schnitzschränke stehen und an dessen Wänden die kostbaren Ölbilder großer alter Meister hängen, Der Baron wirft keinen Blick auf diese Dinge, an denen sein Herz so sehr hängt. Seine trüben Gedanken beschäftigten sich jetzt mit ganz anderen Dingen.
Zwei Tage vorher hatte sich Benigna in die Stadt fahren lassen, um einiges zu besorgen, wie sie ihrem Vater gesagt hatte, Sie kaufte zuerst Blumen und ging dann zu Fuß in die Altstadt, wo der Schreiner Hobelsberger ein großes Sarglager unterhielt. Der Geschäftsmann empfing die ihm unbekannte vornehme Dame, die ein ganz schlichtes helles Sommerkleid trug, sehr höflich und wunderte sich, als die Baronesse sagte, dass sie einen weißen Sarg benötige, Wenn sonst Kunden kamen, die einen Sarg zu bestellen hatten, trugen sie jeweils dunkle Kleider, zeigten sich in Trauer aufgelöst und von Wehmut erfüllt. Diese so hübsche, junge Dame verriet aber nichts von schmerzlicher Erregung; sie benahm sich vielmehr so, als ob es etwa bloß einen Tisch oder einen Stuhl zu kaufen gäbe, Als Hobelsberger fragte, wer denn gestorben sei, und sein Beileid ausdrücken wollte, antwortete die Baronesse ausweichend und ersucht sehr bestimmt, aber höflich, sie sogleich in das Lager zu führen. Dort, in einem großen, düsteren Raum, standen in einem langen, zweigeschossigen Gestell Särge aller Arten und Größen, schwere Metallsärge, kunstvolle Eichensärge, solche herkömmlicher, einfacher Art und auch ganz billige Armeleutesärge. Sie alle harrten hier in Stille ihrer Bestimmung, über kurz oder lang letzte Ruhebetten für noch lebende Unbekannte zu werden. Der Tischler hoffte, einen sehr teuren Sarg verkaufen zu können. Die Baronesse aber wählte nach kurzer Prüfung einen der ganz schlichten, weißen Fichtenholzsärge ohne jegliche Verzierung, wie man sie für die Geringsten zu verwenden pflegt. Sie fragte nach dem Maße, sah, dass es stimmte, und nach dem Preise, und ersuchte, den Sarg am übernächsten Tag punkt zehn Uhr am Eingang des Schlosses Hohenaich abzuliefern. Sie beglich die Rechnung und hinterließ für den Fahrer einen Zwanzigmarkschein als Trinkgeld, damit der Sarg ja genau zur genannten Stunde vor das Schloss gebracht würde.
Dann entnahm sie ihrer Handtasche ein kleines Kruzifix aus Silber, ein erlesenes, altes Kunstwerk, und übergab es dem Tischler mit dem Auftrag, es auf dem Sargdeckel zu befestigen, Weiteren Zierrat, betonte sie ausdrücklich, wünsche sie keinesfalls.
Dann blieb sie eine kurze Weile vor dem Sarg stehen, berührte ihn ganz leise, lächelte und verließ das Geschäft, Kopfschüttelnd und verwundert blickte der Tischler der seltsamen jungen Dame nach.“
Das also hatte sich zwei Tage vorher in der nahen Stadt ereignet. Nun tritt der Baron zögernd an die Türe, die zu Benignens Zimmer führt, horcht erst ein paar Augenblicke und klopft dann an, Er klopft ein zweites und drittes Mal, nun etwas kräftiger, Aber es kommt keine Antwort, Fast wagt es der von schweren Ahnungen Erfüllte nicht, die Türe zu öffnen. Dann macht er sie leise auf, betritt das Zimmer und bleibt wie erstarrt stehen. Die Beine wollen ihm den Dienst versagen.
In einem hohen Armstuhl, der mit einer Myrten bestecken alten Brokatdecke verhängt ist, sitzt, friedlich zurückgelehnt, Benigna in vollem Brautschmuck. Zu ihren Füßen liegt das Brautbukett, Benigna scheint zu schlafen.
Endlich vermag sich der Vater seinem Kinde zu nähern. Er fasst ihre Rechte und hebt sie empor. Die Hand sinkt leblos in den Schoß zurück, "Benigna, Kind, Liebstes!" ruft der Vater in tiefstem Schmerze, "Benigna, wach auf, rede!" Aber Benigna kann nicht aufwachen und sprechen. Tote schlafen für immer und schweigen für immer.
Bald findet der Baron den Brief, der an ihn gerichtet ist. Darin steht zu lesen, dass seine Tochter Gift genommen habe, weil ihr das Leben unerträglich geworden sei. Wohl habe sie es vermocht, allen Schmerz über ihre Enttäuschung zu verheimlichen. Aber diesen zweiten September, der ihr Hochzeitstag hätte sein sollen, könne sie nicht überleben. Der gütige Gott werde ihr, so hoffe sie, verzeihen. Auch ihr Vater möge das tun, so bäte sie herzlich. Man möge sie in aller Stille und ohne jeglichen Prunk im Dorffriedhof und nicht in der Familiengruft bestatten. In jenem Sarge, den sie sich selbst gekauft habe. Weitere Anweisungen für ihr Begräbnis, für Bestimmung Ihres Vermögens und ihrer Habseligkeiten sowie die Bitte um Aushändigung der hinterlassenen Briefe und Andenken beschlossen den Brief.
Das Wetter hatte umgeschlagen. Frühherbstlicher Glanz und milde Sonne waren gewichen, Am Himmel trieben graue Wolken; über dem Gäuboden brüteten Donaunebel. Nebel krochen auch die Waldberge hinan und gaben Benigna Freiin von Hohenaich das Geleite, als sie still und ohne jedes Gepränge auf dem Dorffriedhof von Alt -Hohenaich zur Ruhe bestattet wurde. An ihrem Grabe stand viel kleines Volk, das mit ehrlichen Tränen seine geliebte, gütige Freundin beweinte. Weil die Entschlummerte ihre Grabstatt unterm freien Himmel und bei den kleinen Leuten hatte haben wollen, öffnete sich diesmal die düstere Familiengruft der Herren von Hohenaich nicht.
Wie oft hatte sich Benigna dieses dunkle Gewölbe aufschließen lassen, um Zwiesprache zu halten mit Ihren dahingegangenen Ahnen. Auch stand sie gerne im Gotteshaus vor den prächtigen Marmorgrabmälern ihrer Vorfahren, darauf die alten Herren und Frauen ihres Geschlechtes in stolzer Haltung stehen und redselige Inschriften erzählen von ihrem Leben, Wirken und Ende. Immer wieder sah sich dabei Benigna, ergriffen von dem Grabmal jenes
adligen Sprossen, der im achtzehnten Jahrhundert als holder Knabe dahingesunken war. Da schlummert der Knabe, aus hellem Marmor gehauen, so sanft und so gut, lächelt selig und stützt mit der Hand das Lockenhaupt, das auf einem Totenschädel ruht, wohl wissend, dass man hier, bei dem besten und treuesten Freund, auch den besten Schlaf tun könne ...
Unter den von Benigna hinterlassenen Andenken befand sich auch jenes Goethebuch, das für meine Freundin Maria bestimmt war und dazu führte, diese Geschichte mitzuteilen. Wer sie liest und vielleicht einmal den Gäuboden entlang fährt, mag sich etwa veranlasst fühlen, Ausschau zu halten nach dem stolzen, schönen Waldschloss mit seinen mächtigen, weißen Flügeln, seinen hohen Giebeln und Türmen, wie es groß und einsam die dunklen Gipfel der blauenden Wälder überragt.
Dieses Schloss wurde bald nach Benignens Tod von den Machthabern der damaligen Zeit mit Beschlag belegt, um in ihm Akten und andere Dinge, denen man Ewigkeitswert zumaß, in vollkommener Sicherheit, wie man wähnte, zu bergen. Damals nahm der Gutsherr wieder Wohnung im Schloss von Alt-Hohenaich. Allein die gegen Kriegsende einrückenden Sieger hatten Kenntnis von den im neuen Schlosse verwahrten Gegenständen erhalten. Sie sprengten es. Seither ragen aus den Wäldern jener Höhe Ruinen von erschreckendem Ausmaß.
Reisende, die nicht unterrichtet sind von der kurzen Geschichte und dem Untergang des einst fürstlichen Sitzes, wähnen wohl, dass dort in mittelalterlichen Fehden eine riesenhafte Burg zerstört worden sei. Sie können es auch nicht wissen, dass dort nur ein einziges Mal Hochzeit gefeiert wurde. Freilich eine sehr stille und düstere, die Hochzeit mit dem Tode ...
Anmerkung zum Leben und Werk des Heimatdichters Max Peinkofers
Max Peinkofers Peinkofer geb. 22.09.1891 in Tittling, gest. 06.05.1963 in Zwiesel, war Schriftsteller und Journalist. Die Ausbildung als Lehrer legte den Grundstock für seine heimatkundliche Arbeit. 1925 übernahm er die Schriftleitung der Passauer Zeitungsbeilage „Heimatglocke". Max Peinkofer stand bald im Mittelpunkt eines Kreises von Heimatkundlern und Volksdichtern. Er verfasste auch historische Abhandlungen, Sagen und Gedichte. Mit dem Dichter Hans Carossa pflegte er eine Freundschaft.
1951 erhielt er den Literaturpreis. Zu seinen Werken zählen: Der Brunnkorb. Die Fünferlkuh, Waldweihnachten, Die Hochzeit mit dem Tode, Büchlein von der Englburg, Das Pandurenstüberl (nach Bosl, Bayerische Biographie).
Die von Hans Agsteiner gekürzte Originalgeschichte aus dem Werk „Hochzeit mit dem Tode. Eine Geschichte aus unseren Tagen“ von Max Peinkofer aus dem Jahr 1959 wurde bereits im September 2002 im Gemeindeboten der Gemeinde Steinach veröffentlicht. Sie erzählt die Geschichte von Berta von Schmieder.
Max von Schmieder
von Dr. Thomas Grundler
Die Jugend und Schulzeit
Max von Schmieder wird am 1.4.1908 in München als einziger Sohn von August von Schmieder und dessen Ehefrau Mary geboren, wächst im Neuen Schloss Steinach auf und wird dort bis zum 14. Lebensjahr (1922) von Privatlehrern unterrichtet. Seine hohen sportlichen und auch musischen Talente werden anscheinend bestens gefördert, wie sein weiterer Lebensweg zeigt.
 Max von Schmieder im Alter von etwa 8 Jahren
Max von Schmieder im Alter von etwa 8 Jahren
Obwohl sein Vater und seine Mutter gute Reiter sind und im Gestüt viele Pferde gehalten werden, ist Max von Schmieder von jungen Jahren an nicht für den Pferdesport oder gar das Reiten zu begeistern. Er liebt das Motorrad- und Autofahren.
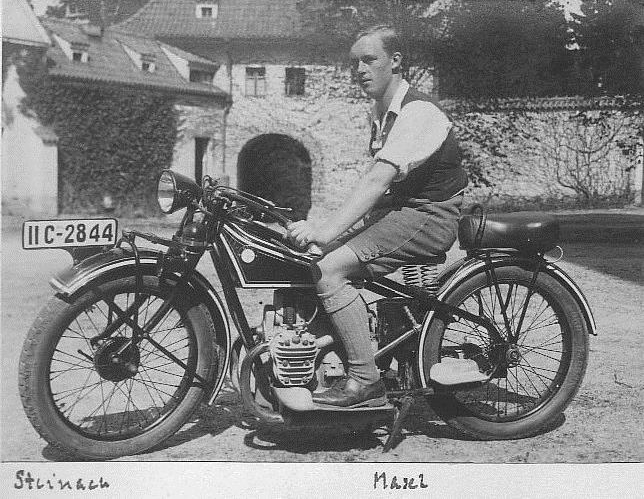
Max von Schmieder mit seinem geliebten BMW Motorrad um 1924
Ab 1922 besucht Max von Schmieder das Gymnasium und Internat in Schondorf am Ammersee, wo er 1927 mit dem Abitur abschließt.
Ausbildung und Studium
1927 und 1928 absolviert Max von Schmieder seine landwirtschaftliche Lehre bei Herrn Cornelius auf der Domäne Hainsburg in Sachsen, seit dieser Zeit kann er perfekt „Sächseln“, was er zum Gaudium in Gesellschaft manchmal macht.
1929 nimmt Max von Schmieder das Studium der Landwirtschaft zunächst für ein Semester an der Universität Göttingen auf, dann wechselt er an die Technische Universität Freising-München nach Weihenstephan, wo er 1931 das Studium der Agrarwissenschaften mit dem Titel des Diplomlandwirtes erfolgreich abschließt.
1933 promoviert Max von Schmieder am Lehrstuhl für Agrikulturchemie bei Prof. Dr. Niklas zum Dr. agr. mit einer Dissertation zum Thema: „Kritische Untersuchungen über das Wesen, die Anwendbarkeit und Übereinstimmung einiger Schnellmethoden zur Feststellung der Phosphorsäurebedürftigkeit des Ackerbodens“.

Max von Schmieder als Student
Max von Schmieders Münchner Zeit
Nach der Promotion zieht es den frischgebackenen Doktor der Agrarwissenschaften allerdings nicht direkt zurück nach Steinach in die große elterliche Landwirtschaft und die im Aufbau befindliche Saatzucht. Durch seinen Vater und durch Ökonomierat Ludwig Niggl sind die „Führungspositionen“ in Steinach fest besetzt. Zudem bindet Max von Schmieder sein großes sportliches Engagement an München. Er spielt sehr erfolgreich Tennis beim Münchner Renommierclub „Iphitos“, wo er zu dieser Zeit in der ersten Mannschaft steht, 1931 Südbayerischer Mannschaftsmeister wird und somit zu den besten bayerischen Tennisspielern zählt.
Max von Schmieder geht seinen künstlerischen Fähigkeiten nach und betreibt ein Büro für Werbegrafik und Design in München1,2.
Beim Tennis lernt er seine erste Frau kennen, die Krefelderin Edith Pobell, ebenfalls eine gute Tennis- und vor allem Hockeyspielerin. Am 3.5.1934 heiraten die beiden in Krefeld und wohnen anschließend vorrangig in München, haben aber im Alten Schloss in Steinach eine kleine Wohnung, die sie nutzen, wenn sie sich in Steinach aufhalten3. Erst 1937 zieht Max von Schmieder mit seiner Frau, seinem Vater und seiner Schwester Berta wieder ganz nach Steinach ins Alte Schloss. Max und Edith von Schmieder beziehen den 1. Stock mit dem wunderbaren, von außen uneinsehbaren Garten. Für August von Schmieder und seine Tochter Berta wird im 2. Stock Wohnraum geschaffen, in dem der große, nach Süden raus liegende Saal in mehrere kleinere Räume unterteilt wird.
Ludwig Niggl, der mit seiner Familie seit der Fertigstellung des Neuen Schlosses im Alten Schloss wohnt, zieht in das gerade fertig gestellte eigene Haus im Kirchweg3.

Hochzeit Dr. Max von Schmieder und Edith Pobell, 1934 in Krefeld
von links: Max von Schmieder, Karl August von Schmieder, Edith Pobell, ?, Hilde Pobell, Mary von Schmieder, Alexander Pobell, ?, Hildegard Pobell, Werner Pobell, Martha Schmieder
vorne sitzend: Ernestine von Schmieder, Berta von Schmieder, Ilse Pobell
Die Militärzeit
1937 meldet sich Max von Schmieder freiwillig zur Luftwaffe, wo er als Flakschütze ausgebildet wird. 1939 nimmt er am Polenfeldzug teil und ist – wie aus seinem Wehrpass hervorgeht - bis zum 11.3.40 bei der Fliegerhorstkompanie in Lodsch stationiert1,2.
1938 und 1939 werden die beiden Söhne Carlmax und Wolfgang von Schmieder in Straubing geboren.
Am 12.3.1940 wird Max von Schmieder als Feldwebel aus der Wehrmacht entlassen und „UK“ gestellt. Er erhält im Reichsnährstand eine sehr interessante Aufgabe: Als Leiter der neu geschaffenen „Beratungsstelle für Futterpflanzensämereien“ des „Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzucht“ organisiert er in den deutschen Ostgebieten und im angeschlossenen Österreich die Produktion von Futterpflanzensaatgut. Auch damals wird ein Großteil des Futterpflanzensaatgutes, wegen der besseren klimatischen Bedingungen, im Ausland produziert. Abgeschnitten von den Importen aus Übersee ist es zwingend notwendig, in Deutschland selbst ausreichend Saatgut guter Qualität zu produzieren. Für Max von Schmieder ein Glücksfall. So reist er durch die Lande, berät landwirtschaftliche Betriebe im durchaus diffizilen Anbau von Futterpflanzen zur Saatgutproduktion, muss keinen Kriegsdienst verrichten und kann zudem in regelmäßigen Abständen nach Steinach zu seiner Familie zurückkehren. Als allerdings 1941 sein Vater überraschend verstirbt, ist er gerade irgendwo im Osten Europas unterwegs und schafft es nicht rechtzeitig zur Beerdigung nach Steinach zu gelangen.
Im Sommer 1944 befürchtet Max von Schmieder, dass die Rote Armee bis nach Niederbayern vorstößt. Edith von Schmieder und ihre Schwester Hilde Schorsch, die zuhause in Düsseldorf ausgebombt worden ist und nun mit ihrer Kindern Marina (geb. 1935) und Philipp (geb. 1938) in Steinach lebt, beginnen Lebensmittel einzudosen und Kleidung etc. zu packen. In einer Nacht im Oktober 1944 bringt Max von Schmieder seine Frau, seine beiden 6 und 7 Jahre alten Söhne Wolfgang und Carlmax sowie Hilde Schorsch mit ihren beiden Kindern aus Sicherheitsgründen auf die eigene Jagdhütte „Gschwand“ bei Oberammergau. Die beiden Frauen und die Kinder bleiben dort 9 Monate (!) bis in den September 1945.

Carlmax, Edith und Wolfgang von Schmieder um 1946
Zerstörung des Neuen Schlosses
In das 1939 von der Rechsautobahn erworbene und seitdem als Arbeitsdienstlager genutzte Neue Schloss Steinach wird ab 1943 die NSDAP-Parteizentrale aus München verlegt. Am 23.April 1945 stecken die noch verbliebenen Wachmannschaften – wohl in Panik vor den schnell heranrückenden Amerikanern – das Schloss in Brand. Da keine Löschversuche unternommen werden dürfen, brennt das Schlossgebäude völlig aus. Die Ruine steht bis 1955, dann werden die Keller zugeschüttet, die Wände abgetragen und zu Ziegelsplitt verarbeitet. Als 1960 die Bundesautobahn das Gelände zum Verkauf ausschreibt, will Max von Schmieder „das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen“ und gibt kein Gebot ab. Den Park und die noch stehenden, von einigen Flüchtlingsfamilien bewohnten Gebäude erwirbt Robert Sporn aus Straubing.

Ruine des Neuen Schlosses in Steinach um 1950
Die Nachkriegszeit
Beim Zusammenbruch im Mai 1945 ist Max von Schmieder bereits in Steinach. Da das Alte Schloss der amerikanischen Besatzungsmacht als Kommandantur dient, wohnt er – seine Familie bleibt bis September 1945 auf der „Gschwandhütte“- kurzzeitig im sog. „Haus 105“ in der heutigen Straubinger Strasse in Steinach.
Sein Schwager Ewald Grundler, der 1943 die jüngere Schwester von Edith von Schmieder Ilse Pobell geheiratet hatte, trifft im Juli 1945, gerade aus der Gefangenschaft entlassen, in Steinach ein. Max von Schmieder beauftragt ihn – da er selbst wegen einer schweren Gelenksentzündung das Bett hüten muss – auf dem Gut Einhausen, das Max von Schmieder für seinen noch minderjährigen Sohn Wolfgang bewirtschaftet, nach dem Rechten zu sehen. Dort haben sich fremde Personen breit gemacht, die „durch die Konjunktur hier hereingekommen sind“, wie mein Vater in seinem Tagebuch vermerkt4. Erst mit Hilfe der Militärpolizei können sie zum Verlassen des Gutes gezwungen werden. Ewald Grundler bleibt auf dem nun verwaisten Gut in Einhausen und als 2 Tage später am 9.Juli 1945 seine Frau Ilse, auf der Suche nach ihm eintrifft, übernimmt er zunächst den Wiederaufbau von Gut Einhausen, um dann ab den Fünfziger Jahren auch leitende Aufgaben in der Saatzucht Steinach übertragen zu bekommen.
Zusammen mit seinem Schwager Ewald Grundler baut Max von Schmieder die Saatzucht wesentlich aus, gewinnt neue Vermehrer von Saatgut in Westdeutschland, vor allem in Unterfranken und Schleswig-Holstein. Er ist in allen wichtigen Gremien und Verbänden der Deutschen Pflanzenzüchtung tätig und wird für seine Verdienste um die Deutsche Pflanzenzüchtung 1958 mit der Bayerischen Staatsmedaille in Silber geehrt.
Kreativ sucht Max von Schmieder neue Geschäftsfelder. Man beginnt in Steinach ab 1950 mit der gezielten Züchtung von Rasengräsern. Max von Schmieder bekommt als erster deutscher Züchter 1955 mit der Sorte „Rasengold“ eine Rasensorte zugelassen.
Daneben wird in den „Baumschulen Steinach“ die Produktion und Züchtung der schnell wachsenden Baumarten Pappeln, Baumweiden und Aspen neu aufgenommen.
Nochmals sportliche Erfolge
Auch nach dem Krieg ist Max von Schmieder weiterhin ein sehr erfolgreicher Sportler. Sein geliebtes Tennisspiel betreibt er nun für Rot-Weiss in Straubing, wo er in der 1. Mannschaft auf Platz 1 steht. 1953 und 1954 wird Max von Schmieder mit immerhin 45 bzw. 46 Jahren Straubinger Stadtmeister im Herren Einzel.

Max von Schmieder als Tennisspieler bei Rot-Weiss Straubing, ca. 1953
Als hervorragender Schrotschütze findet Max von Schmieder großen Gefallen an dem von den Amerikanern nach dem Krieg nach Deutschland gebrachten Skeetschießen. Max von Schmieder bestreitet viele nationale und internationale Skeet-Wettkämpfe. Mehrfach gelingt es ihm von den 100 Tontauben im Wettkampf 99 zu treffen. Seine größten Erfolge im Skeet feiert Max von Schmieder in den Jahren 1960 bis 1962:
- Deutscher Mannschaftmeister 1960

Deutscher Mannschaftsmeister in Skeet 1960
von links: Herr Sigl(?), Konrad Wirnhier, Walter Skersies, Max von Schmieder
- 1. Platz Schwäbische Meisterschaften 1960
- 2. Platz Deutsche Meisterschaften 1961
- Internationaler Österreichischer Staatsmeister 1961
- Süddeutscher Meister 1961
- Teilnahme an der Weltmeisterschaft Oslo 1961
- 10. Platz Europameisterschaft Bern 1961
- Bronzemedaille mit der Mannschaft, Europameisterschaft Bern 1961
- 1. Platz im Qualifikationsschießen für die Weltmeisterschaften Kairo 1962
- Süddeutscher Meister 1962
- Bayerischer Meister 1962
- Niederbayerischer Meister 1962
- 2. Platz im Länderkampf Deutschland – USA 1962
- 1. Platz Internationales Wurftaubenschießen München 1963
Mit diesen Erfolgen ist Max von Schmieder bis dahin Steinachs erfolgreichster Sportler.
Mit Recht ist er besonders stolz darauf, dass er Conny Wirnhier, den späteren Weltmeister und Olympiasieger von 1972 in München, für diesen Sport begeistert und dessen erster Lehrmeister ist.
Verleihung der Ehrenbürgerwürde
Anläßlich seines 50. Geburtstages erhält Dr. Max von Schmieder 1958 die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Steinach verliehen.
 Dr. Max von Schmieder an seinem 50. Geburtstag 1958 mit seiner Mutter und einer Reihe von Mitarbeitern
Dr. Max von Schmieder an seinem 50. Geburtstag 1958 mit seiner Mutter und einer Reihe von Mitarbeitern
1. Reihe: Mary von Schmieder, Dr. Max von Schmieder, Xaver Kapfer, Frau Student
2. Reihe: Max Kapfer, Josef Ried, Walter Knobloch, Lotte Schötzau (verdeckt), Herr Stalter, Georg Oswald
3. Reihe: Karl Lauterbach, Traudl Niggl, Irmgard Geiger
4. Reihe: Leonhard Kameter, Urban Zimmermann, Paul Matthießen, Erich Frank, Fritz Theumer
Der Verkauf von Schlossgut Steinach
1963 entscheidet sich Max von Schmieder Schloss, Gutsbetrieb und Saatzucht Steinach zu verkaufen.
Im gleichen Jahr noch wird die Ehe von Max und Edith von Schmieder geschieden. Edith von Schmieder zieht 1964 nach Gut Einhausen und später ins Schloss Saulburg, das ihr Sohn Wolfgang von Schmieder 1965 kauft und renoviert. Edith von Schmieder verstirbt am 1.März 1982 und wird in Saulburg zu Grabe getragen.
Max von Schmieder erwirbt in der Nähe des Chiemsees den „Göttfriedhof“ in Meisham bei Eggstätt. Dort beginnt er mit seiner zweiten Frau Liane von Bressensdorf, die er im Januar 1964 heiratet, in ausgedehnten, von ihm neu erbauten Glashausflächen eine Rosenzucht und beliefert Blumengeschäfte in München und in der näheren Umgebung täglich mit frischen Schnittrosen.
Nach wie vor pflegt er seine sportlichen Hobbys, zum Tennis ist der Golfsport gekommen. Lange Jahre hält er ein „einstelliges Handicap“ und noch mit 82 Jahren gewinnt er die Clubmeisterschaft in seinem Golfclub in der Altersklasse „über 55“.
Im Sommer 1998 kommt er zum letzten Mal mit seiner Frau Liane nach Steinach, besucht das Familiengrab, fährt mit mir durch die Saatzucht, zum Schanzlweiher, ins Gestüt , zum Riedhaus (aber nicht zum Neuen Schloss), zum Helmberg und zum Schluss spaziert er mit Saatzuchtleiter Philipp Berner durch „seinen“ Zuchtgarten.
Am 23.Januar 1999 verstirbt Dr. Max von Schmieder im hohen Alter von fast 91 Jahren auf seinem Wohnsitz in Meisham.

Max von Schmieder im Alter von ca. 80 Jahren
Bilder:
Alben Mary von Schmieder, Hubertus Meckel, München
Liane von Schmieder, Meisham
Quellen:
- Carlmax von Schmieder, 2005: Mündliche Mitteilung
- Liane von Schmieder, 2005: Mündliche Mitteilung
- Traudl Niggl, Steinach 2005: Mündliche Mitteilung
- Ewald Grundler, 1944-45: Tagebuch
Berta von Schmieder
von Dr. Thomas Grundler und Claudia Heigl
Berta von Schmieder wird am 15.02.1916 als jüngstes Kind von Karl August und Mary von Schmieder in München geboren. Benannt wird sie nach der besten Freundin ihrer Mutter Berta Morena, der berühmten Wagnersängerin an der Münchner Hofoper.

Mary und August von Schmieder mit ihren Kindern Ernestine, Berta und Max im Park des Neuen Schlosses Steinach, 1918
(Foto: Alben von Mary von Schmieder)
Das Nesthäkchen Berta ist Papa’s Liebling und wächst wohlbehütet im Neuen Schloss Steinach auf. Wie ihre älteren Geschwister Ernestine (*1905) und Max (*1908) wird auch sie von einem Privatlehrer unterrichtet und besucht keine öffentliche Schule.
Das riesige Schloss mit seiner weitläufigen Parkanlage ist für die Kinder ein Paradies. Viele Künstlerfreunde der Eltern und hochgestellte Personen des Bayerischen Adels sind oftmalige Gäste im Haus. Dies wirkt sich auch auf die Erziehung der Kinder aus.

Karl August von Schmieder mit den Kindern Berta, Max und Ernestine im Schlosspark
(Foto: Alben von Mary von Schmieder)
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges verliert August von Schmieder einen beträchtlichen Teil seines Vermögens, das in Auslandspapieren angelegt war, die nun verloren sind. Durch die Inflation 1922 und die Weltwirtschaftskrise 1928 verringert sich das liquide Vermögen von August von Schmieder nochmals erheblich. Konnte die Familie von Schmieder vor dem Ersten Weltkrieg nicht einmal die Zinsen des Geldvermögens aufbrauchen, so müssen nun Sparmaßnahmen ergriffen werden.
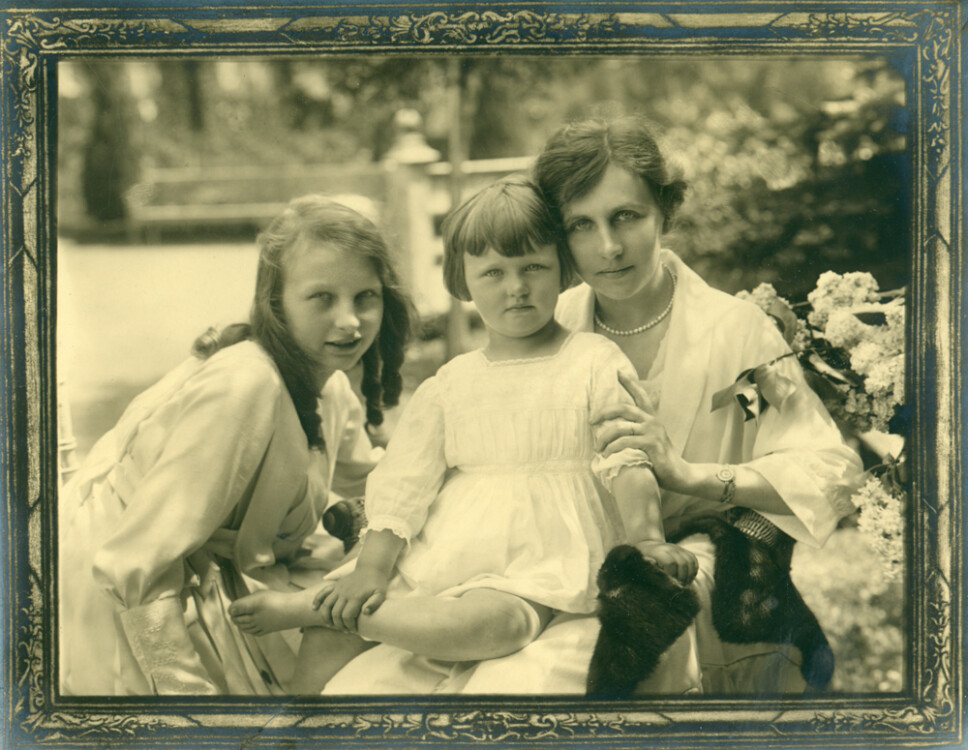
Mary von Schmieder mit ihren Töchtern Ernestine und Berta
(Foto Grainer)
1930 verlässt die Familie das Neue Schloss Steinach und legt es still, da die Unterhaltskosten der riesigen Schlossanlage zu hoch sind. Die damals 14-jährige Berta zieht mit ihrer Familie nach München in die Wohnung in der Ohmstraße.
 Mary und August von Schmieder anlässlich ihrer Silbernen Hochzeit am 7. September 1929
Mary und August von Schmieder anlässlich ihrer Silbernen Hochzeit am 7. September 1929
mit ihren Kindern Berta, Max und Ernestine im Neuen Schloss Steinach
(Foto: Alben von Mary von Schmieder)
1934 heiratet Bertas Bruder Max und 1935 ihre Schwester Ernestine. 1937 kehrt Karl August von Schmieder zusammen mit der jungen Familie seines Sohnes Max und der nun 21-jährigen Berta zurück nach Steinach ins Alte Schloss. Dort wird im südlichen Teil des Zweiten Stocks im ehemaligen Schlosssaal für August von Schmieder und seine Tochter Berta eine eigene Wohnung eingerichtet. Max von Schmieder bewohnt mit seiner Frau Edith und den beiden Kindern Carlmax und Wolfgang das erste Stockwerk.
Bertas Mutter Mary von Schmieder bleibt in München wohnen und zieht später mit ihrer Freundin Berta Morena nach Rottach-Egern. Aufgrund ihrer freundschaftlichen Kontakte zu jüdischen Persönlichkeiten werden der Sängerin von den Nationalsozialisten unter dem falschen Vorwand, sie sei Jüdin, der Zutritt zum Nationaltheater verboten, sowie jegliches Auftreten erschwert1.
Während sich ihr Bruder Max 1937 freiwillig zur Luftwaffe meldet und 1939 am Polenfeldzug teilnimmt, bleibt Berta mit ihrem Vater und ihrer Schwägerin Edith allein in Steinach. Berta meldet sich zum freiwilligen Dienst als Krankenschwester und wird in den Lazaretten in Straubing und in Regensburg eingesetzt. Auch in Steinach hilft sie bei der Pflege von alten und kranken Menschen und ist dadurch im Dorf sehr beliebt.

Berta von Schmieder
Bild: Nachlass Ludwig Niggl
Während ihrer Tätigkeit im Lazarett in Regensburg lernt sie den verwundeten Oberleutnant Fritz St. von Königsberg kennen und lieben.
Weihnachten 1939 feiern sie ihre Verlobung in Steinach, zu der auch ihre Mutter anreist. Laut Überlieferung in der Familie löst der Bräutigam die Verbindung jedoch schon bald wieder.

Das Brautpaar mit August und Mary von Schmieder anlässlich der Verlobung
Bild: Ilse Grundler
Als Berta‘s geliebter Vater August von Schmieder am 6. März 1941 plötzlich und unerwartet verstirbt, ist dies für die Tochter ein zusätzlicher Schock. Ihr Bruder Max versieht zwar keinen Wehrdienst mehr, ist aber im Auftrag des Reichsnährstandes in den deutschen Ostgebieten unterwegs und erreicht Steinach nicht bis zur Beerdigung des Vaters und muss bald danach wieder abreisen und seinen Dienst versehen. Berta bleibt mit ihrer Schwägerin und ihren zwei kleinen Neffen Carlmax (geb. 1938) und Wolfgang von Schmieder (geb. 1939) zurück in Steinach.

Berta von Schmieder kurz vor ihrem Tod
(Foto Ilse Grundler)
Knapp sieben Wochen nach dem Tod des Vaters, stirbt die 25-jährige am 22. April 1941 in ihrem Zimmer im 2. Stock des Alten Schlosses an einer Überdosis Schlaftabletten.
Ihren Freitod hat von Berta von Schmieder sorgfältig geplant. An ihrem Todestag liefert ein Straubinger Schreiner einen Sarg in das Alte Schloss. Was zunächst für einen Irrtum gehalten wird, denn im Schloss war kein Todesfall zu verzeichnen. Erst nach längerer Nachforschung stößt man auf die verschlossene Tür von Berta’s Zimmer und bricht diese schließlich auf.
Es wird noch schnell nach der alten Hebamme Kreszenz Bachl geschickt, da diese medizinische Kenntnisse hat und in Schlossnähe wohnt. Doch auch sie kann nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.
Berta von Schmieder wird sieben Wochen nach ihrem Vater in der Schmiederschen Familiengruft auf dem Steinacher Friedhof beerdigt.
Gut Einhausen, dass Berta nach dem Tod ihres Vaters geerbt hat, vermacht sie ihrem Neffen, dem erst zweijährigen Sohn ihres Bruders Wolfgang von Schmieder.

Die Beerdigung fand unter großer Anteilnahme der Steinacher Bevölkerung statt
Bilder: Max Hiegeist, Hoerabach
Der Schriftsteller und Heimatforscher Max Peinkofer nahm die tragische Geschichte der Berta von Schmieder als Grundlage für seinen 1959 erschienenen Roman „Hochzeit mit dem Tode“.
Peinkofer gibt die Geschichte jedoch nicht detailgetreu wieder, sondern verändert sie stark. Nach seiner Erzählung wohnt die Braut im Neuen Schloss Steinach und ihr Vater war noch am Leben. Auch war die Familie in dem Roman schon seit Generationen auf dem Herrensitz mit eigener Familiengruft. In Wirklichkeit war die ehemalige alte Gruft der Steinacher Schlossbesitzer aber bereits lange abgetragen. Für August von Schmieder wurde nach seinem Tod eiligst eine neue, kleine Gruft auf dem Steinacher Friedhof gemauert. Neben ihm liegen dort auch die sterblichen Überreste seiner geliebten Tochter Berta.
Überraschenderweise existiert noch eine weitere Theorie zum Freitod der jungen Frau.
Der Steinacher Pfarrer Josef Aschenbrenner hat eine Notiz hinterlassen, die er am 6. September 1957 verfasst hat2:
Im Juli 1957 kam ich ins Bad Wörishofen-Sebastianeum. Dort fragte mich Fruktus über Frl. Berta von Schmieder, die 1941 durch Schlaftabletten das Leben nahm, und die er im Lazarett der Barmherzigen Brüder in Straubing bei ihrer Tätigkeit als Krankenschwester kennengelernt hatte.
Ich berichtete ihm, daß die liebenswürdige Dame eine hochangesehene Persönlichkeit kennengelernt und sich in ihn verliebt habe, er wurde untreu, und das sei ihr so nahe gegangen, daß sie sich das Leben nahm; sie wurde beerdigt in der Schmiederschen Familiengrabstätte, die beim Tode des Herrn von Schmieder errichtet wurde; dabei wurde vom Schloß und Pfarrkirche das Steinpflaster gelegt.
Fruktus stellte den Grund zum Freitod: Verfehlte Liebe in Abrede und sagte, was Aschenbrenner Pfarrer damals in Steinach ganz neu war:
Sie habe sich über Hitler und sein Tun abfällig geäußert, deswegen sei sie vor die Alternative gestellt worden: Entweder würde sie ehrlos getötet oder sie müsse sich selbst das Leben nehmen. Das letztere hat sie getan in ihrem Zimmer im hiesigen Schloß, allgemein in Steinach bedauert.
Dieser Fund wirft ein anderes Licht auf den Freitod von Berta von Schmieder. In der Familie von Schmieder wurde nur die Version der unglücklichen Liebe weitergegeben. Allerdings waren die beiden kleinen Neffen noch im Säuglingsalter und auch später wurde über den Selbstmord der Tante in der Familie kaum gesprochen. Pfarrer Aschenbrenner maß der Aussage jedoch große Bedeutung bei, ansonsten hätte er den Vermerk nicht der Chronik beigelegt.
Was nun wirklich ausschlaggebend für Bertas Selbstmord war, kann abschließend nicht mehr geklärt werden.
Die Inszenierung des Freitodes und seine ungeklärten Hintergründe sind ein besonderes Kapitel in der bewegten Geschichte des Alten Schlosses Steinach und der Familie von Schmieder in Steinach.
1 Seite „Berta Morena“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. August 2020, 10:15 UTC.
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berta_Morena&oldid=202490086 (Abgerufen: 1. Mai 2021, 17:18 UTC)
2 Pfarrarchiv Steinach, Geschichte von Steinach mit Ergänzungen von Pfarrer Josef Aschenbrenner
Johann Baptist Schiedermayr
von Hans Agsteiner

Johann Baptist war am 23. Juni 1779 in Münster als viertes Kind des Schulleiters Johann Georg Schiedermayr und dessen Ehefrau Maria Scholastika, geb. Augustin, geboren.
Von seinem Vater wurde er früh in Singen unterrichtet und kam in seinem neunten Lebensjahr 1788 als Sängerknabe in das Prämonstratenserstift Windberg. Hier wurde er im Gesange ausgebildet und lernte das Klavier spielen, teils von einem gewissen Obergaßner, teils von seinem älteren Bruder Georg, der in Windberg Organist war.
1791 kam er in das Benediktinerkloster nach Oberalteich, wo der Grund zu seiner späteren musikalischen Ausbildung gelegt wurde.
1793 ging er nach Straubing in das kurfürstliche Studienseminar, wo er mit 14 Jahren unter den 24 Schülern der beste Orgelspieler war. Thaddäus Wolfgang Freiherr von Dürnitz, einer der besten Pianospieler seiner Zeit, erteilte ihm Unterricht. Zwei Latein-Lehrer bildeten ihn an den Instrumenten Flöte und Violine aus. Mit 15 Jahren begann er zu komponieren- ein Tantum ergo mit vier Singstimmen, ein Alma – redemtoris mater – und eine Messe in D-Dur für seinen Vater.
1796 verließ er das Seminar, da eine sehr harte Strafe des Musik-Seminarinspektors das Ehrgefühl des 17jährigen tief verletzte. Er ging nach St. Nikola, einem Chorherrenstift bei Passau, wo er anfänglich als Bassist, dann als Organist angestellt wurde.
Schiedermayr wollte eine Priesterlaufbahn einschlagen und hatte bereits das zweite Jahr der Theologiestudien begonnen, als die Aufhebung der Klöster 1802 seinen Entschluss Geistlicher zu werden, mächtig erschütterte. Er bewarb sich auf die vakant gewordene Stelle des verstorbenen Türmermeisters Eggerstorfer in Schärding. Die Vergabe der Stelle war jedoch mit der Bedienung verbunden, einer der drei hinterlassenen Töchter von Eggerstorfer zu heiraten, wobei die Älteste den Vorrang hätte. Trotz seines Vorspiels, dass großen Beifall fand, wurde er abgewiesen, da er sich nicht entschließen konnte die älteste Tochter zur Frau zu nehmen.
Am 24. Februar 1804 kam er nach Linz, wo er unter dem damaligen Dom- und Stadt-Kapellmeister Franz Glöggl in der Kirche, im Theater und bei der damals bestehenden Bürgergarde zu verschiedenen Instrumente verwendet wurde, bis er in der Folge 1810, als der Erste die bisher getrennten Stellen eines Dom- und Stadtpfarr-Organisten in Vereinigung erhielt.
1807 vermählte sich Schiedermayr mit der jüngeren Tochter Eggerstorfers, Barbara, deren Bekanntschaft er bei jenem Probespiel in Schärding gemacht hatte.
Mancherlei Rückschläge, bedingt durch die damaligen kriegerischen Ereignisse und die Teuerung jener Hungersjahre, erschütterten Schiedermayrs Vermögensverhältnisse und brachten die Familie in arge Bedrängnis. In der Sorge um das Fortkommen und um seinen Kindern eine entsprechende Ausbildung geben zu können, bürdete er sich außer vielen privaten Lehrstunden zusätzlich anstrengende Tätigkeiten auf.
Als 1821 die Gesellschaft der Musikfreunde (später Linzer Musikverein) gegründet wurde, erhielt Schiedermayr das Ehrenamt eines „Leiters am Klavier“. Zu gleicher Zeit übernahm er auch den Unterricht an der 1822 gegründeten Musikschule (heute Linzer Bruckner-Konservatorium). Hier wirkte Schiedermayr mit unermüdlichem Eifer für die Ausbildung junger Talente bis zum Jahr 1837. Seine erfolgreiche Tätigkeit wurde mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Noch einmal übernahm er auf besonderen Wunsch die Leitung der Gesellschaftskonzerte. Auch als Theaterkapellmeister (von 1835-1839) erwarb er sich große Verdienste, wenn auch diese Stelle mancherlei Unannehmlichkeiten mit sich brachte. Volle Befriedigung gewährte ihm jedoch die Arbeit im Bereich der Kirchenmusik. Seine Meisterschaft im Orgelspiel bestätigten ihm damals anerkannte Persönlichkeiten dieses Fachs.
Mit seinen zahlreichen kirchlichen Kompositionen: Messen, Vespern, Litaneien, Offertorien usw. wollte Schiedermayr vor allem die „Kirchenmusik auf dem Lande“ und bei den einfacheren Chorverhältnissen verbessern und fördern. Haydn und Mozart waren die großen Vorbilder seines kompositorischen Schaffens, wobei er künstlerische Gediegenheit mit Popularität zu vereinen suchte.
Gegen Ende des Jahres 1839 waren die Anzeichen einer schweren Erkrankung festzustellen. Trotzdem versah Schiedermayr an den Weihnachtstagen den gesamten Kirchendienst. Ganz erschöpft musste er nach Hause gebracht werden. Rasch nahmen seine Kräfte ab. „So schnell kann doch der Tod nicht kommen – er muss doch vorher anklopfen“, meinte er, ehe er sich der notwendigen Operation unterzog. Diese verlief zwar glücklich, unvorhergesehene Begleitumstände und ein Schlaganfall machten seinem Leben am 6. Januar 1940 ein Ende.
Aus seiner Ehe mit Barbara Eggerstorfer (1783-1858) gingen acht Kinder hervor:
- Johann Baptist Schiedermayr (1807-1878),
studierte Theologie mit der abschließenden Promotion zum Dr. theol., er wurde 1830 zum Priester geweiht. Seit 1845 gehörte er dem Linzer Domkapitel an, wo er zur Würde eines Domdechants und eines infulierten Dompropstes emporstieg;
- Joseph Schiedermayr (1808 - 1819)
- Maria Schiedermayr (1810 - 1889)
- Wilhelm Schiedermayr (1812 - 1855), Amtsvorstand des Bezirksamts und -gerichts in St. Florian
- Barbara Schiedermayr (*1814)
- Rosa Schiedermayr (1816 - 1874)
- Karl Schiedermayr (1818 – 1895)
zeigte schon in frühester Jugend ein bemerkenswertes musikalisches Talent. Sein Vater drängte jedoch auf ein naturwissenschaftliches Studium. Er studierte seit 1837 an der Universität Wien Medizin und erlangte 1843 die Doktorwürde der Medizin. 1845 begab er sich in seine Vaterstadt Linz, um dort die ärztliche Praxis auszuüben. Sein besonderes Interesse für die Botanik, vorzugweise für die Kryptogamen (= blütenlose Pflanzen) veranlaßte ihm 1849 zur Übersiedlung nach dem Markte Kichrdorf im Kremstal. Er bekleide die Stelle eines Bezirksarztes für Kirchdorf und Steyr, war Korrespondent der meteorologischen Zentral-Anstalt und Mitglieder mehrerer ärztlichen und naturwissenschaftlichen Gesellschaften und Vereine. Außerdem veröffentlichte er größere Abhandlungen und zahlreiche Aufsätze in den einschlägigen Fachzeitschriften. Schiedermayr starb als hochgeschätzter Experte der Botanik.
- Josef Schiedermayr (1821-1874), Advokat
Quelle:
Agsteiner Hans, Steinach – Eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, 1996
Scharnagl A., Johann Baptist Schiedermayr in „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“, Band 11 derselbe „Anton Bruckner lernte von ihm“. Johann Baptist Schiedermayr zum 200. Geburtstag, Straubinger Kalender 1979
Josef Schlicht
Schlossbenefiziat, Heimatforscher und Klassiker der bayerischen Volkskunde
von Hans Agsteiner
Am 18. März 1832 wurde Josef Schlicht in Geroldshausen in der Hallertau (Marktgemeinde Wolnzach) geboren. Seine geistliche Laufbahn führte ihn 1871 nach Steinach, wo er bis zu seinem Tod am 18. April 1917, also 46 Jahre lang, als Schlossbenefiziat wirkte.
Als Volkskundler und Volksschriftsteller brachte es Schlicht zu großer Berühmtheit. Seine Veröffentlichungen wurden weit über Bayern hinaus bekannt und gerne gelesen. Ein Freundeskreis brachte dies auf einer Gedenktafel in der Steinacher Pfarrkirche mit folgendem Spruch zum Ausdruck: „Wie keiner kannte, liebte und schilderte er das altbayerische Bauernland“.
Die Geschichte von Steinach wurde von ihm ausführlich erforscht und veröffentlicht.
Das Andenken an Josef Schlicht wird in der Gemeinde Steinach hochgehalten. So ist ihm u. a. ein Straßenname gewidmet – die Schlichtstraße in der Oberen Siedlung – und die Grundschule Steinach trägt seinen Namen.
Josef Schlicht ist auch heute noch von überregionaler Bedeutung. Mehrere seiner Bücher wurden neu aufgelegt, seine Erzählungen erscheinen in Zeitschriften und Kalendern und der Landkreis Straubing-Bogen ehrt seit 1977 Persönlichkeiten, die sich besonders herausragende Verdienste um Heimat, Kultur und Brauchtum erworben haben, mit der Verleihung der Josef-Schlicht-Medaille.

Josef Schlicht
aufgenommen ca. 1890
(Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Nachlass Ludwig Niggl)
Arme Kindheit
Josef Schlicht war der erstgeborene Sohn einer kinderreichen Gütlersfamilie, die einen Hof mit 14 Tagwerk bewirtschaftete. Von seinen 17 Geschwistern überlebten elf das Kleinkindalter nicht.
Sein Vater war „in der Junggesellenzeit ein Zither-, Sing- und Schützenblut, ohne Falsch von je, ehrliebend, sehr viel Gemüt; seine Mutter liebherzig, flink, frohsinnig, in Rede und Gebärde eine Landanmut von ihrem Jugendgeschäft, dem Kleidermachen“. So berichtet Schlicht über seine Abstammung.
Josef Schlicht wäre beinahe unehelich zur Welt gekommen, da die „Bauernfünfer“ (Vorläufer des Gemeinderats) die Eheerlaubnis für seine Eltern mangels Vermögen verweigerten. Heiraten durften damals – mit Blick auf die Armenkasse – nur, wer eine gesicherte Existenz aufweisen konnte. Schlichts geistliche Laufbahn wäre als uneheliches Kind kaum möglich gewesen. Aber es kam anders. Schlichts Vater erbte das „Bergmartlgütl“ und konnte nun seine große Liebe heiraten. Die 1830 geborene illegitime Tochter Theresia wurde legitimiert.

Der malerische gelegene Ort Geroldshausen, Marktgemeinde Wolnzach in der Hallertau -
Hier ist Josef Schlicht am 18. März 1832 geboren und hier verbrachte er seine Kindheit
(Foto: Hans Agsteiner, Februar 2007)
Nach Schlichts autobiographischen Angaben verlebte er anfangs eine frohe, dann aber eine eher traurige Kindheit. Mit drei Jahren hat der kleine Josef Glück im Unglück. So beschreibt er später ein gefährliches Erlebnis: „Aus Lebenslust mit Armen und Beinen schlegelnd, glitt er, hinaus in das Feld auf dem Ernteleiterwagen, unversehens seiner Mutter vom Schoß und kugelte dabei so unter den leeren Erntewagen hinein, dass ein Hinterrad aufstieg und kaltblütig über seinen Kopf hinwegging: „Es tat ihm sonst weiter gar nichts, als dass es ein wenig bremselte und die jugenddämmrigste Rückerinnerung in sein drittes Lebensjahr ist“.
Es waren zunächst frohe unbeschwerte Kinderjahre, ausgefüllt mit Spiel und kleinen Arbeiten für die Familie.
Am 8. Oktober 1838, der kleine Josef war gerade mal sechs Jahre alt, starb seine Mutter bei der Geburt eines Geschwisterchens im Alter von 30 Jahren. Die neugeborene kleine Theresia folgte ihr am 27. Oktober im Tode nach.
Es klingt wie Erinnerung an die Leichenfeier seiner „liebherzigen, flinken, frohsinnigen“ Mutter, wenn er später in seinen „Kulturskizzen“ schreibt: „Er steht am Grab seiner Mutter, gegängelt von der kindlichen Liebe. Begreiflich, da unter geweihter Erde liegt jenes Auge, das über ihn gewacht, jenes Ohr, das sich nie seinem Hilferuf verschlossen, jener Mund, der um seinetwillen gedarbt, jenes Herz, das für ihn geschlagen, jenes Haupt, das auf sein Glück gesonnen… Und habt ihr denn, als wir sie wegtrugen aus ihrem Hause, nicht gehört das herzzerreißende unstillbare Wimmern und Wehklagen ihrer Kinder? Mann und Kinder weinen untröstlich um die gute Mutter.“
Blutet bei Schlichts Erzählung nicht das Kinderherz wieder?

Ehemaliges Elternhaus von Josef Schlicht in Geroldshausen
(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)
Das Gebäude war zu Schlichts Zeiten eingeschossig und mit einem Strohdach gedeckt.
Bis etwa 1955 hatte es einen Giebelerker über der Haustür. Um 1955 wurde es um ein Geschoss erhöht (siehe Bild).
1978 wurde Schlichts Elternhaus abgebrochen und durch den heutigen Neubau mit einer Erinnerungstafel für Josef Schlicht über dem Eingang ersetzt.
(Freundliche Informationen durch den Urgroßneffen von Josef Schlicht, Herrn Matthäus Schlicht, im Februar 2007)
Seine „ereignisschwere Knabenzeit“ konfrontierte ihn ständig mit dem Tod und gerade mit dem Sterben jener Menschen, die ihm besonders nahe standen, sein erster Lehrer und sein erster Pfarrer. Während der Pfarrer geistesgestört ins Wasser sprang, brachte sich der ledige Lehrer nach einem Wirtshausbesuch selbst Verletzungen am Arm bei und verblutete.
Schlichts Vater heiratete wieder. Mit dem Einzug der Stiefmutter war für den kleinen Josef aber die Nestwärme entschwunden. Schlicht schreibt in seiner Autobiographie: „Den ersten Lebensbund seines Vaters schloss die Liebe, den zweiten nur mehr das Geld; daher brachte dieser wohl noch einen starken Kinderzuwachs von sechs lebenden Köpfen, aber die wahre Harmonie der Seelen niemals. Nach seinem sechsten Jahr hörte das Vaterhaus auf, ihm sein trautes, süßes Heim zu bleiben. Er selbst war freilich auch kein stilles, kosiges Stiefkind, eher ein halsbrechend wilder Bube: Auf dem First des Elternhauses (s’war noch das alte liebe Strohdach) auf dem Kopfe stehend, das zählte noch lange nicht zu den tollkühnsten Stücken“.

Erinnerungstafel an Josef Schlicht
an dessen Geburtsstätte in Geroldshausen, Hauptstraße 44
(Foto Hans Agsteiner, Februar 2007)
Da sich noch weitere nachkommende Geschwister um den Tisch drängten, musste der Vater daran denken, den Ältesten von der Suppenschüssel wegzubringen. Er sollte das ehrsame Stiefelmachen erlernen. Doch dagegen sperrte sich der Quicklebendige, und er wurde Hüterbub.
Er war ein gewitztes Bürschlein und fand das Wohlgefallen seines Pfarrers Josef Hilmer, der ihn dann nach dem herkömmlichen Lehrjahr im Pfarrhof für eine geistliche Laufbahn im Auge hatte.
Studienjahre in Metten und Regensburg
Es folgen nun acht Lateinschul- und Gymnasiumsjahre im Benediktinerkloster Metten.
Dort gehörte er „niemals unter die Ersten, aber auch unter die Letzten niemals, sondern jedes Mal und unentwegt zur Kern- und Mittelgruppe“, so schildert er später diese Jahre.
Am 12. August 1852 erhielt Schlicht das Reifezeugnis. Eigentlich wollte er an der Universität studieren, doch scheiterte dies am fehlenden Geld. In dieser Zwangslage richtet er ein erfolgreiches Gesuch an „Seine Bischöflichen Gnaden“ um Aufnahme ins Klerikalseminar: Nach dem Studium am Lyzeum waren die religiösen Übungen im Priesterseminar an der Reihe.
Am 12. August 1856 erhielt Schlicht die Subdiakonats- und am Tag darauf die Diakonatsweihe.
Am 16. August desselben Jahres wurde er im Hohen Dom zu Regensburg von Bischof Valentin von Riedel zum Priester geweiht. Als „Supernumerarius“ (wörtlich: „Überzähliger“) wurde er eingesetzt, wo er gerade nötig war.
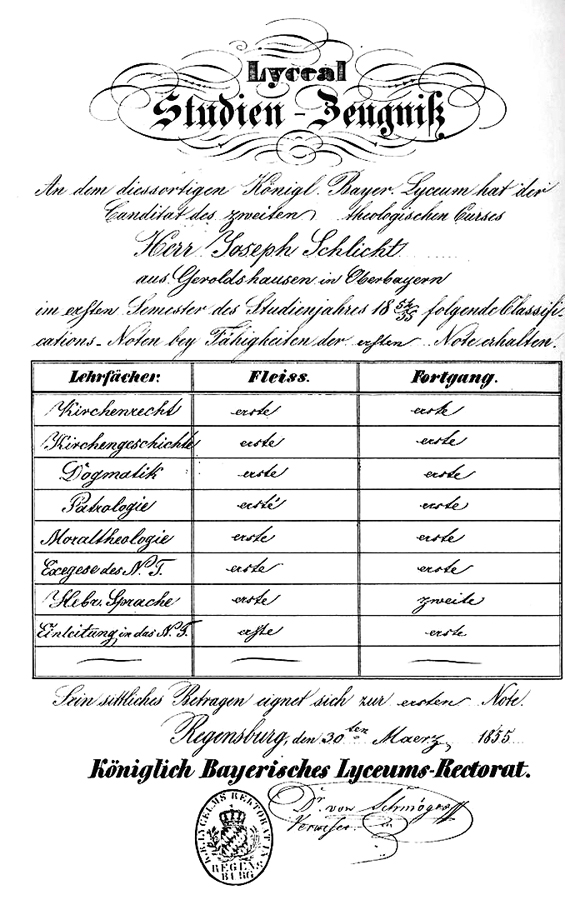 Schlichts Hochschulzeugnis von 1855
Schlichts Hochschulzeugnis von 1855
(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)
Schlichts Reisen
Vor seiner Priesterweihe 1856 wollte der junge Mann noch etwas von der Welt sehen. 1853 reiste er so nach Prag, Dresden, Berlin, Hamburg. In Hamburg erlebt er eine internationale Stadt, wundert sich über die „14 – 18 thousands of joy-girls“, sieht ganze Züge von Auswanderern. Dann geht es weiter nach Braunschweig, Leipzig, nach Vierzehnheiligen und Bamberg und endlich nach München.
Den Süden erwandert Schlicht in seinem ersten theologischen Jahr, 1854: Kochelsee, Murnau, Hohenschwangau, Hindelang und Immenstadt, nach Lindau und Konstanz.
Im nächsten Jahr wandert er über Ulm, Straßburg und Chalons auf die berühmten „Katalaunischen Felder“. Paris war ihm mehr als eine Messe wert. Auf der Rückreise steigt er bei einem Landpfarrer in Burgund ab. Dann ging es über Basel und Zürich nach Einsiedeln.
Von seinen mindestens 20 Reisen, von denen er später viele aus Steinach antrat, sind noch zu nennen: Böhmen, Franken, Oberschwaben, drei nach Kärnten, Tirol, die Steiermark und Vorarlberg, Rheinland und ins Oberland, Wien und Ungarn.
Schlicht verliebt, aber abgebrannt!
Dr. Rupert Sigl schreibt im „rechten treuen Baiernspiegel“: „Als er auf der Heimkehr von seiner Nordenfahrt an einem Abend in froher Runde sein Herz an ‚Amalie’ verlor und ihre offenbar einseitige Liebe in einem Gedicht besingt, mochte ihm seine finanzielle Ohnmacht und Misere noch grausamer erschienen sein: "Nur Tränen können wir vergießen… Die Lieb ist in uns viel zu kräftig, als dass sie in uns bleiben soll".
So hat auch die unabdingbare Not das Problem der Liebe mit entschieden. Obschon ein Pfennigfuchser von Kleinauf, ging es Schlicht gerade in dem Jahr vor der Priesterweihe sehr nass ein. Er stand sogar mit seinem Talar in der Kreide.
Erste Stationen seiner geistlichen Laufbahn
Zwischen 1856 und 1870 war Josef Schlicht an fünf verschiedenen Orten als Kooperator beschäftigt: 1856 in Ensdorf, 1857 in Ergoldsbach, 1858/59 in St. Nicola in Landshut, 1859-69 in Oberschneiding, 1869/70 in Tunding, 1870 in Stadtamhof.
Die Gemeinden, an denen Schlicht tätig war, wiesen unterschiedlichen Charakter auf. Schlicht war sowohl mit rein bäuerlich-ländlicher als auch mit städtischer Struktur durch seine Versetzungen vertraut.
Damals sprach noch niemand von Priestermangel, sodass er in Oberschneiding fünf Jahre als Unter- und zweiter Kaplan und fünf weitere als Ober- und einziger Kaplan beim Pfarrer und Dechant Tobias Leutner verbrachte. Bei diesem Muster an volksnaher Seelsorge lernte Schlicht seine Gäubodenbauern sehr genau kennen.
Der "kloa Herr" von Schneiding
Schlicht schreibt in seiner Autobiographie über diese Zeit: „Diese gäuländische Zeit, namentlich die frühere Hälfte, war überaus schön, so schön, dass ihm der Gedanke oder gar das Fieber, auch einmal Pfarrer zu werden, nicht im entferntesten kam …. Im Verkehr mit der ganzen rund umliegenden Geistlichkeit fehlte nichts; denn auf allen vier Weltecken des Pfarrsprengels hatte er einen Bauern, der einen Schießer für ihn bereit hielt, im Sommer mit Kutsche, im Winter mit Schlittengeißl, einige Zeit gab es sogar einen habsburgischen Husarenbraun aus dem italienischen Feldzug von 1859 zum Ausritte.“

Der ehemalige Pfarrhof in Oberschneiding, erbaut 1858
(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)
Als Josef Schlicht am 3. September 1859 in dem mächtigen Gäudorf Oberschneiding eintraf, war dort Josef Pritzl erster Kaplan, "da grouß Herr", der beinahe siebenthalb Schuh lang war (Anm.: über 2 Meter)“. Er besaß zu seiner großen Kooperatur die entsprechende leibliche Höhe und Dicke wie eine gute alte bayerische Stundensäule, und dazu die gesetzte, ernste, ruhige Gangweise, Gebärde und Rede. Wenn „da Kloa und da Grouß zu Weihnachten, Ostern oder Pfingsten dem Pfarrer levitierten, ging in der Tat beim Friedenskuß der Kloa dem Groußn nur bis zum Nabl“.
Schlicht war nicht nur in seiner Kindheit ein quicklebendiger Junge; diese Eigenschaft ist ihm bis ins Alter erhalten geblieben.
Einen jähen Schrecken jagte er einer abergläubischen jungen Mutter ein. Er musste als so genannter „kleiner Herr“ (d.h. Unterkooperator) wegen Abwesenheit des Oberkooperators ihren Knaben taufen. Als die Hebamme mit dem Kind heimkam, die Frage: „Was für einer hat ihn denn getauft?“ Und sogleich die Wehklage der Wöchnerin: “Mein Gott, möchte mir der Bub ein rechter Unend (=Auftreiber) werden!“.
Die kreuzbrave Bauersfrau, welche den kleinen Herrn (vielleicht nicht ganz ohne Grund) für allzu lebendig hielt, bangte (darin natürlich ohne Grund), dass derselbe bei der Taufe seine Lebendigkeit und damit ein strampelndes Temperament auf ihren Säugling übertragen hätte.
Schneiding, diese Bauernmetropole, darf sich rühmen, Schlichts Bild vom Baiern und Bauern wesentlich geprägt zu haben. Die Pfarrei und die umliegenden Bauerndörfer bildeten den Goldgrund zu unzähligen Szenen und Bildern (Sigl).
Erste schriftstellerische Schritte
In die 1850er Jahre fiel die erste Beschäftigung Schlichts mit volkskundlichen Schriften. Gegen Ende der Oberschneidinger Zeit (um 1868) wurde Schlicht von Georg Aichinger, dem Schriftleiter des „Straubinger Tagblatts“ gebeten, Beiträge für die Zeitung zu liefern. Aichinger war mit Schlicht in Metten und dessen Beichtvater in Azlburg. Schon bald erkannte Aichinger Schlichts schriftstellerische Begabung.

Er brachte Schlicht zur Schriftstellerei: Georg Aichinger, Redakteur und Beichtvater
(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)
Unter dem Titel „Von der Hienharter Höhe“ (ein Gutshof in der Nähe von Oberschneiding) erschienen ab dem 18. Juli 1868 unregelmäßige „Landskizzen“ von Schlicht im „Straubinger Tagblatt“. Waren es am Anfang lustige Geschichten, die gern gelesen wurden, so entstanden nach und nach auch ernste politische und kirchliche Artikel.
Schlicht liebte die Leute, so wie sie waren, mit ihrem Dorfjux, wie sie einander aufzwickten, miteinander kämpften, die Kleinen gegen die Großen. „Dem Seniorbauern“ und der „Plendlbäuerin“, bei denen er ein- und ausging, hat er seine besten Portraits gewidmet.
Das vielsagendste Kulturbild malte er vom „Aumer von Gmünd“, der von einem tollwütigen Hund gebissen, wochenlang dem Tod vor Augen, seine wahre Größe im Sterben erreichte.
In Tunding und in Regensburg
Schlicht berichtet in seiner Autobiographie über seine weiteren Einsätze: „Im Jahre 1870 folgten der weniger schwere Kaplanposten und das Pfarrprovisorat in Tunding und 1871 … die Kommendistenstelle auf dem Benefizium zu Stadtamhof; ebenfalls ein schönes Jahr mit all jenen vielen Anregungen, welche das hochbegehrte kirchliche Geistes-, Vereins- und Kunstleben Regensburgs unter der Bistumsführung des Bischofs Dr. Ignatius von Senestrey jederzeit reichlichst bietet“.
Für den Schriftsteller und Volkskundler war Tunding-Lengthal ungewöhnlich fruchtbar. In diesem abgelegenen Holzland fand Schlicht das alte Brauchtum besser erhalten als in dem noblen, echten Gäudorf Schneiding. Hier notierte er bei einer Hochzeit, was wir später in seinem Büchlein als „Landhochzeit“ finden.
1871 - Schlicht wird Schlossbenefiziat in Steinach
Eng verbunden mit dem Steinacher Schloss ist das heute noch bestehende Schlossbenefizium, das auf eine uralte adelige Stiftung zurückgeht. Im Jahre 1336 hat das Rittergeschlecht der Warter von der Wart durch Kauf den Steinacher Edelsitz übernommen. Noch im selben Jahr errichtete Ritter Ekolf von der Wart am Turm der Pfarrkirche St. Michael die Begräbnisstätte der steinacherischen Warter und erbaute darüber die Kapelle St. Maria, in der er mit einem Zinskapital von 3 600 Regensburger Pfennigen eine „Ewige Messe“ für das Seelenheil seines Geschlechts stiftete. Durch Zustiftungen wurde das Benefizium auf bessere finanzielle Beine gestellt, sodass ein Schlossbenefiziat sein Auskommen hatte. Das Steinacher Schlossbenefizium ist ein sog. Inkuratbenefizium, d.h. ein Benefizium ohne Kura. Daneben bestand die Burgkapelle St. Georg, die nach ihrem Abbruch im 16. Jahrhundert durch die heutige Schlosskapelle ersetzt wurde. Der Schlossbenefiziat hatte – nach Schlichts späteren Forschungen – folgende Aufgaben zu erfüllen:
- An der Begräbnis- und Benefiziumskapelle St. Maria in der Woche die zwei Stiftmessen für die verstorbenen Warter lesen.
- An der Burgkapelle St. Georg ebenfalls in der Woche zwei Messen lesen.
- Darüber hinaus die Messen an jedem Feiertag in der Burgkapelle zu zelebrieren, wenn die Schlossherren nicht zur Pfarrkirche gehen können oder wollen.
- In den vier Quatemberzeiten eine Brotspende an die Armen der Hofmark geben.

Die Steinacher Schlosskapelle St. Georg - Wirkungsstätte des Schlossbenefiziaten
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Dem Benefiziaten wurde ein eigenes Haus gekauft, „wohlgebaut und wohlgelegen“. Dazu bekam er noch 34 Tagwerk Feld und Wald. Das Patronatsrecht am Benefizium hatten natürlich die Stifter und ihre Nachfolger bzw. die Steinacher Schlossherrschaft und die Krone. Die Patronatsherren konnten den Benefiziaten vorschlagen. Nach und nach verlagerte sich das Benefizium von der Gruft- und Stiftungskapelle St. Maria an die Schlosskapelle St. Georg. Die Marienkapelle mit ihren Begräbnisstätten wird im Jahr 1798 als „gänzlich baufällig“ bezeichnet und schließlich abgebrochen.

Josef Schlicht nach einer Fotografie vom 3. Januar 1898,
aufgenommen für seine Autobiographie und das "Niederbayern-Buch"
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
1871 erhält Josef Schlicht das Steinacher Schlossbenefizium und wird Schlossbenefiziat. In seiner Autobiographie von 1898, in der er von sich immer in der dritten Person redet, als schaue Schlicht sich selber zu, berichtet er über die damaligen Vorgänge:
„Nach jenem Jahre stellte sich merkwürdigerweise auch bei ihm ein Fieber ein; allerdings nicht das Pfarrfieber; denn dieses durfte sich damals mit 20 Kaplanjahren erst einstellen, aber das Expositusfieber, und weil sich auch das mit 16 (Priester-) Jahren noch zu früh einstellte, so war es eigentlich nur ein Hausschlüsselfieber. Und den bot ihm, nachdem das Folium der Kuratpfründen noch zu allem und jedem den Kopf wiegte, das Benefizium von Steinach in reizendster Landlage in Niederbayern und aus königlichem Patronat“.
In Steinach erwartete Schlicht – so Rupert Sigl in „Josef Schlicht – Der rechte treue Baiernspiegel“, im Folgenden „Sigl/Baiernspiegel“ genannt – eine Sinekure (Anm. = eine einfache Arbeit) für sein Werk, das viel freie Zeit als Preis verlangte, zumal er ein langsamer Schreiber war. Er brauchte eine lange Anlaufzeit, um „hoaß zu werden“; dann erst begann die Sprache mit ihm zu spielen und zu flirten, die Einfälle, die erst nur tröpfelten, fingen dann zu nieseln, zu rieseln, zu rinnen, zu gießen und niederzuprasseln an, um plötzlich wie blind herumzutasten nach einem bestimmten Ausdruck, den er ahnte, aber nicht fand. So musste er jedes Blatt immer wieder neu schreiben, bis er „abbellte“ wie ein Hund. Darum sind seine Seiten, die uns erhalten blieben, ohne jede Korrektur.
Nicht zu klären ist es nach Sigl, wie Schlicht auf Steinach verfiel. Sigl vermutet, dass sein Vorgänger Franz Xaver Leonhard über Georg Schießl die Fäden knüpfte. „Am 24. August 1871 um Steinach beworben“, notiert er in seinem Taschenbuch. Am 27. August setzte ihn der Steinacher Schlossbesitzer Eduard von Berchem-Königsfeld in Kenntnis, „dass das Benefizium erledigt wird – im Fall Sie zu einer Besprechung kommen wollen“.
Am 13. Oktober meint Berchem-Königsfeld, die Sache sei im Ministerium. „Man hat Sie meinem Wunsch gemäß primo loco vorgeschlagen. Der Referent meint, der Minister wird dabei bleiben. Wenn der also keinen Strich dazwischen macht, wären alle Chancen für Sie, und ich glaube, Sie können sich schon vorbereiten, im Erinnerungsfall recht bald zu kommen, da es meiner Frau beschwerlich ist, in die Pfarrkirche zu gehen“. Im Vertrauen verriet er Schlicht, dass er allgemein getadelt werde, weil er einen so jungen Herrn wünschte. Am 15. November wurde Schlicht als Schlossbenefiziat in sein Amt eingeführt.
Eduard von Berchem-Königsfeld, dessen Mutter eine Gräfin von Königsfeld war, hatte 1839 das Schloss Steinach gekauft und 1860 den Adelstitel „von Berchem-Königsfeld“ verliehen bekommen. Auch seine Frau Natalie, eine geborene Gräfin von Deym zu Arnstorf, rechtfertigte diesen neuen Titel, war doch ihre Mutter Josefine eine Gräfin von Königsfeld. Der neue Schlossherr machte den beiden Berchem-Linien, der gräflichen wie der freiherrlichen, alle Ehre. Er konnte das Schlossgut Steinach auf 1 450 Tagwerk vergrößern.

Eduard Freiherr von Berchem-Königsfeld
Bild: Familie von Berchem
Schlicht wohnte im Benefiziatenhaus, in der Nähe der Pfarrkirche, las am Morgen in der Schlosskapelle die Messe um halb acht Uhr und im Sommer sogar um halb sieben. Zum Widdum gehörten zu Schlichts Zeiten 45 Tagwerk, davon allein 34 Tagwerk Holz, das wenig abwarf. Die Warterische Inkuratspfründe, wie sie richtig hieß, war eine „Arbeitspfründe bescheidensten Anspruchs“, sagt er selbst, der 42. Schlosskaplan.

vorne das Benefiziatenhaus mit Stadel und großem Garten
aufgenommen ca. 1956
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Zum ersten Mal musste er sich einen eigenen Haushalt einrichten und obendrein die Dächer auf Haus und Stadel sowie den Zaun erneuern lassen und einen Brunnen graben.
Seitenweise notiert Schlicht alle Anschaffungen und Preise. Sein Schreibtisch allein schon verschlang 40 fl. und ein zweiter 19 fl. Die Aufzählung der Fenster verrät, wie das Haus bewohnt wurde:
„3 im unteren Wohnzimmer, detto im oberen, 1 in der Speise, 1 in der Küche, 2 im Fremdenzimmer, 1 in Köchinzimmer, 2 im Schlafzimmer“.
Im Obergeschoss brauchte er acht neue Fensterstöcke. Küche und Flur wurden gefliest, die Dachrinnen erneuert.
Seine Wohnung stattete Schlicht sehr einfach, aber geschmackvoll aus, berichten die Freunde und Besucher. Unvorstellbar einfach für unsere Begriffe: ein Rohrsessel, vier Bettstellen, eine Uhr, zwei Spucknäpfe, sechs Sesseln, vier Tische und eine Kommode und was sonst nötig ist, Waschtisch, Schirmständer, Vorhangstangen. Die 231 Gulden vom ersten Jahre reichten keineswegs. Er musste seine Ersparnisse aus seiner Kaplanszeit dazulegen.

Das Benefiziatenhaus - Schlichts Wohnhaus - aufgenommen um 1910
Vor allem Fenstern hatte der Blumenliebhaber rote Geranien
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Entscheidend war für ihn jetzt, seine Freiheit voll auszunutzen. Nach der Messe nahm er das Frühstück zu sich, das aus einer „saueren Suppe“ mit Bratkartoffeln bestand, genau wie daheim in Geroldshausen. Die „Hirgstmilch“ wurde für den Winter in einen Zuber geschüttet und aufbewahrt und dann mit Mehl und Wasser aufgekocht. Nie in seinem Leben, berichten uns seine Freunde Ludwig Niggl, Dr. Höpfl und Eduard Stemplinger, habe er Kaffee oder Tee angerührt, noch habe er geraucht, ebenso verschmähte er Wein. Nur das „hupfad Wasser“, wie er den Sekt nannte, schätzte er über alles.
Schlichts Tagesablauf
Zuerst zelebrierte er, wie oben dargestellt, den Gottesdienst in der Schlosskapelle. Nach dem Frühstück ging es ans Studium bis 11 Uhr. Danach nahm er ein einfaches Mittagessen ein, das ihm immer ausgezeichnet schmeckte. Nachmittags machte er bei jedem Wetter einen ausgiebigen Spaziergang, wobei ihn stets seine zwei kleinen Hunde, Schnackerl und Dantscher, einer hässlicher wie der andere, begleiteten. Er liebte weite Märsche, besonders nach Saulburg und Falkenfels. Hier traf er meist Gesellschaft. Nach einem gemütlichen Spiel und gestärkt durch einige Gläser Bier, trat er den Heimweg an. Nachmittags aß er zu seinem Bier etwas Brot mit Schinken, ein Abendessen nahm er nie ein.

Josef Schlicht bei einem Kartenspiel in Saulburg in geselliger Runde
Zweiter von links Bierbrauer Widmann, rechts neben ihm Josef Schlicht
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
In seinem 55 Dezimal großen Garten stand eine mächtige Haselnussstaude, auf der er sich eigenhändig Tisch und Bank zimmerte, um in luftiger Höhe dem Gesang der Vögel lauschen zu können. „Ohne Vöglein wär’s tot auf der Erde“. Hier in diesem Nest brütete er über seinen Einfällen, studierte und schrieb er, lebte ganz für sich.
Nur wenige Eingeweihte wussten von seiner wandlosen Studierstube in luftiger Höhe. Auch Niggl, sein Duzfreund, bekennt, dort oben habe er mit ihm so manche Stunde philosophiert. Da der „Beni“ (= Benefiziat) Blumen liebte, vor allem wildwachsende war der Blumenschmuck in der Wohnung für ihn das Schönste. Höchstpersönlich erbettelte er sich den Taubendünger für die roten Geranien an sämtlichen Fenstern. Niggl, der erst 1904 als Gutsverwalter nach Steinach kam und daher seinen ersten „Hausbesen“ nicht kannte, rühmt, dass sein dienstbarer Geist das Haus trefflich versah und vorbildlich imstande hielt.
Bei der ersten Wahl seiner Köchin hatte er nämlich eine Niete gezogen. „Mehr einem sündflutlichen Drachen als einer holden Küchenfee“ gleich, machte sie ihm das Leben zur Hölle, berichtet Höpfl. Als sie endlich starb und man ihn fragte, warum er sie bei solchen Verhältnissen nicht schon längst abgedankt habe, meinte er trocken: „Ich habe geglaubt, es ist eine wie die andere“.
Schlicht muss also auch mit den früheren Pfarrerköchinnen nicht sehr erfreuliche Erfahrungen gemacht haben. „Menschen, die am Morgen vor lauter Liab unsan Hergott vom Kreuz reißen möchten und am Nachmittag sich schlecht benehmen, die mag i net“, urteilte Schlicht über Betschwestern und Pharisäer. Dagegen liebte er besonders Menschen mit freiem Blick. Sein Urteil über die Mitmenschen offenbart uns auch seine Ansicht über seine Hündchen. “Schön san s’ net, aber treu. Und das ist die Hauptsache“. Als er einmal von Niggl gefragt wurde, warum er sich keinen Rassehund halte, erwiderte er: „Beim Hund ist es wie bei den Menschen. Das schöne G’schau macht’s nicht aus, sondern der Charakter“.
Schlicht störten vor allem die inoffiziellen gesellschaftlichen Verpflichtungen im Schloss, weil man in ihm nur den Salonlöwen und Unterhalter sehen wollte, vor allem dann, wenn die Schlossherrschaft Empfänge gab. Das ging ihm gegen den Strich. Er versteifte sich auf seine Amtspflichten, zu denen solche Dinge nicht gehörten. Ebenso setzte aber auch der Baron von Berchem-Königsfeld seinen Kopf durch. So wurden die täglichen Messen zum Streitobjekt.
Streit mit Schlossherrschaft und Bischöflichem Ordinariat
Freiherr von Berchem-Königsfeld verharrte auf dem Standpunkt, wenn der Benefiziat Messe lese, dann habe er sie in der Schlosskapelle St. Georg zu lesen. Schlicht aber, gestützt auf das Wissen seines Vorgängers Leonhard in Oberalteich wie von Pfarrer Pentner, „hielt sich für berechtigt, nach eigenem Gutdünken dort zu zelebrieren, wo er wollte, und war deswegen jederzeit bereit, seelsorgliche Aushilfe zu leisten, ohne seinen Patronatsherrn zu fragen“.
Er las jeden Sonntag pflichtgetreu im Schloss die Messe, auch wenn er dann zu einer Predigt bei einem Bruderschafts- oder Kirchweihfest fort musste. Und er hatte dazu drei triftige Gründe: Allzuoft, ehe der Streit begann, hatte er in der Schlosskapelle vor fast leeren Stühlen zelebriert. Noch entscheidender schien ihm aber, dass sich im Pfarrarchiv Unterlagen fanden, aus denen hervorging, dass der Kaplan am Montag und Samstag in der Friedhofskapelle, in der Schlosskapelle aber alle Mittwoch und Freitag die ewige Mess zu persolvieren hatte.
Solche Freiheit kam schließlich auch seinen Überzeugungen von seelsorglicher Pflicht und seinem Geldbeutel zugute; denn die Honorare für seine Artikel und Bücher läpperten sich nur sehr kleinweise zusammen. Für eine Schilderung der Weihnacht erhielt er rund sechs Gulden, der Artikel über den Seniorbauern brachte ihm zehn Gulden, einen Gulden brachte ihm eine Buchseite. Und wenn er auch für die Aushilfe beim Bruderschaftsfest nur drei Gulden bekam, die Pfarrer von Steinach und Münster waren ihm dankbar für seine Hilfe.
Als gütliche Auseinandersetzungen zu keinem Ziel führten, wandte sich Baron von Berchem-Königsfeld beschwerdeführend an die kirchliche Oberbehörde nach Regensburg. In ziemlich deutlicher und kräftiger Sprache erinnerte nun diese unseren Schlicht an seine Obliegenheiten in der Schlosskapelle und verbot ihm, anderswo als dort die Messe zu lesen ohne Zustimmung des Schlossherrn. Schlicht glaubte, das Ordinariat sei ihm feindlich gesinnt, aber zu Unrecht. Auch gegen den Adel war er nun verbittert.
Schlicht muss eine wahre Wut gepackt haben, nachdem das Ordinariat einseitig zugunsten des Schlossherrn entschieden hatte, ohne die Quellen zu prüfen; denn trotz der vielen Arbeit stürzte er sich nun in ein jahrelanges Studium der Urkunden, wie die Notizen in seinen Taschenbüchern zeigen. Sigl meint: „Seiner Rechtfertigung verdanken wir die ‚Geschichte von Steinach’, die er zunächst und zu Lebzeiten des Barons noch in den Unterhaltungsbeilagen des ‚Straubinger Tagblatts’, dann in den Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern und schließlich in gekürzter Form als Buch veröffentlichte“.
Schlichts Forschungen in den von ihm entdeckten Steinacher Schlossurkunden führten zu dem oben dargestellten Ergebnis über die Aufgaben des Schlossbenefiziaten. Schlicht hatte sich mit seinen vier Messen während der Woche haargenau an die Stiftung der ewigen Messe gehalten, nicht aber der Schlossherr und auch nicht das Ordinariat. Sigl meint, dass ohne dieses persönliche Interesse seiner Rechtfertigung der Impuls des Obristen Herwart von Bittenfeld zur Steinacher Geschichtsforschung im Sande verlaufen wäre.
Baron von Berchem-Königsfeld scheint sein Unrecht eingesehen zu haben. 1880 ließ er die Schlosskapelle „reich und kunstprächtig“ nach den Plänen von Domvikar Dengler restaurieren. Der Bischof selbst kam zur Neueinweihung.

So dürfte die Schlosskapelle nach der Renovierung ausgesehen haben.
aufgenommen ca. 1920
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Schlicht und August von Schmieder
Der Besitzer des Puchhofs, Carl von Lang-Puchhof, erwarb Steinach für zwei Jahre. 1901 wurde dessen Freund und späterer Schwiegersohn Dr. August von Schmieder Eigentümer des Steinacher Schlossguts. Damit brach – nach Sigl – für Schlicht, Schloss und Gut eine glücklichere Epoche an; denn mit dem neuen evangelischen Schlossherrn lebte Schlicht in bestem Einvernehmen, was nicht zuletzt auch ein Verdienst des Gutsverwalters Ludwig Niggl war. „Dr. von Schmieder ließ seinem Schlossbenefiziaten das, was er brauchte, volle Freiheit und Unabhängigkeit; das oben erwähnte Verbot des Ordinariats kam in Wegfall“.

Dr. August von Schmieder - Er schätze Josef Schlicht in besonderem Maße und gewährte ihm viele Freiheiten für sein Schaffen.
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Schlicht sorgte auch für unfreiwilligen Humor, wenn er z.B. zu den großen Soireen im Schloss nur im Überzieher erschien. Als ihn die Schlossherrin Mary von Schmieder-Lang aufforderte, seinen Überzieher abzulegen, meinte er ganz betroffen, man sei doch hier nicht auf der Kegelbahn; man könnte also nicht in Hemdsärmeln sitzen.
So wie er sich einen neuen Frack sparte, so kam er ein andermal in Gummischuhen, weil diese seiner Ansicht nach am besten zu den glänzenden Lackschuhen der übrigen vornehmen Gäste passten.
Schlichts politische Einstellung
Schlicht stand anfangs wohl dem Bayerischen Bauernbund nahe. Dr. Höpfl leitet dies aus den Unzuträglichkeiten mit Baron von Berchem-Königsfeld ab, die bei Schlicht zu einer „Verbitterung gegen den Adel“ führte. Doch stand Schlicht nach Sigl mehr auf der Seite der Patrioten.
Vom Bauernbund zog er sich wegen der „proletarischen“ Haltung des Bauernbündlers Wieland zurück.
"Bua, jetzt san d'Wagscheitl brocha..."
Pfarrer Josef Weigert, der eine „Religiöse Volkskunde“ verfasste, bat 1916 Josef Schlicht um eine volkskundliche Rezension, was dieser aber aus gesundheitlichen Gründen ablehnte: „…und dabei noch ein Altersleiden am Gallenstein mit zeitweisen Ausbrüchen. Erst gestern in der Freitagsnacht wieder! Ich kuriere mich selber mit einfachsten Naturmitteln und fahre dabei am besten. Zuvor tüchtiges Ausleeren des bereits grawelnden, weil übergalligen Magens … dann Eintreten des Schüttelfiebers, dann reichlichster Schweißausbruch und dabei bis jetzt noch immer die mächtig rasche Verdampfung des zwar unangenehmem, aber alterserträglichen Leberschoppers, genannt Gallenstein“.

Etwas enttäuscht über die Aufnahme seines Werks beim Publikum sinniert der alternde Schlicht resignierend in seiner Antwort an Josef Weigert: „Ich wollte nichts anderes, als den Bauern in Altbayern allein eine Freude bereiten. Und wie haben sie mir das vergolten? Verstanden haben sie es nicht, ja sogar mit Dummheit und Bosheit einen Ehrenbeleidigungsprozess auf den Hals mir gebracht, mit welchem sie zum Glück bei Gericht abgefahren sind.
Erst über die Grenze Altbayerns, im protestantischen Mittelbaden, am meisten im katholischen Westfalen und wieder im protestantischen Niedersachsen bis nach Bremen hinauf, wurde ich mit Freude und Liebe gelesen, was ich gar nicht beabsichtigte und am allerwenigsten hoffte. Freilich, verstanden haben mich diese Leser ebenfalls nicht, aber ja nicht etwa aus Dummheit, durchmischt mit Bosheit, wie bei uns, sondern ganz allein wegen der Mundartschwierigkeit“.
Zum „Ehrenbeleidigungsprozess“ ist Folgendes zu bemerken: Die Schilderung eines Erlebnisses hätte Schlicht fast vor den Richter gebracht. Es ist die Geschichte vom „Krugelfuchs“. Als das Buch mit der Erzählung über diesen Menschen zum ersten Mal erschien, lebte dieser noch, er erfuhr davon und eilte zum Advokaten. Schlicht, dem auf die Zuschrift des Rechtsanwalts schwül wurde, sammelte bereits Zeugen für die Wahrheit seiner Erzählung, erhielt aber vom Gericht die Mitteilung, dass die Klage wegen Verjährung abgewiesen sei.
Josef Weigert fragte nun bei Schlicht an, ob ihm sein Besuch in nächster Zeit angenehm sei. Schlicht antwortete auf einer Karte vom 28. Februar 1917: „Wählen Sie nur den Tag aus! Ich bin immer zu Hause. Und dann wird es mit der Zwiesprache schon gehen! Schlicht“.
Es wurde dann leider doch nichts daraus. Ein Brief seines Neffen vom 13. April 1917 teilte Weigert nur mit: „Herr Benefiziat, geistlicher Rat Schlicht, ist zur Zeit krank und schwach und daher nicht in der Lage, Ihre interessante Arbeit … durchzusehen … Sein Leberleiden setzt ihm in letzter Zeit sehr zu; er nimmt schon fast 14 Tage gar keine Nahrung mehr, nur etwas Wasser mit Fruchtsaft. Wollen hoffen, dass der geistliche Rat sich wieder herausreißt – aber wie Gott will!“
Noch an seinem Sterbebett wurde deutlich, woraus Josef Schlicht sein ganzes Leben lang schöpfte wie kaum ein anderer. Als sich am 18. April 1917 der Bischöflich Geistliche Rat Josef Schlicht im Alter von 85 Jahren mit den Worten „Bua, jetzt san d’Wagscheitl brocha“ von seinem Freund Niggl und von dieser Welt verabschiedete, starb mit ihm nicht nur ein urwüchsiger Seelsorger, sondern auch ein Klassiker der bayerischen Volkskunde.


Schlichts ursprüngliche Grabstelle auf dem Steinacher Friedhof
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Schlichts volkskundliches Werk
Schlichts Erzählungen kamen so gut an, dass auch andere Zeitungen und Zeitschriften Interesse zeigten. Mit den Artikeln in Straubing erschienen Beiträge im „Augsburger Sonntagsblatt“, später (1879 – 1887) im „Schreibkalender“ von Passau, in den „Oberpfälzer Blättern“, im Landshuter „Schreibkalender“ und sogar im Bremer „Nordwest“.
Weitere Beiträge veröffentlichte Schlicht im „Cäcilienkalender“ und in der „Niederbayerischen Monatsschrift“.
Die Artikel, die im „Straubinger Tagblatt“ und im „Augsburger Sonntagsblatt“ erschienen waren, fasste Schlicht zusammen zu dem Buch „Bayerisch Land und Bayerisch Volk“, das 1875 – also bereits in seiner Steinacher Zeit – auf den Markt kam. Es stand am Anfang einer Reihe von Schlicht-Publikationen, die sich in drei Bereiche einteilen lassen: geschichtliche Abhandlungen – Darstellungen des Bauern in Niederbayern – Theaterspiele. „Bayerisch Land und Bayerisch Volk“ wird bis heute als Schlichts gelungenstes Werk gelobt.
Weitere Publikationen Schlichts sind (in chronologischer Reihenfolge):
- Blauweiss in Schimpf und Ehr (Amberg 1877)
- Altbayernland und Altbayernvolk (1886)
- Die altbayerische Landhochzeit (Amberg 1889)
- Altheimland (Bamberg 1895)
- Niederbayern in Land, Geschichte und Volk (Regensburg 1898)

Folgende Theaterspiele hat Josef Schlicht im Selbstverlag herausgegeben:
- Der Kletzenwabm sei' Friedl (Straubing 1897)
- Die Kavalierswette (Kempten 1903)
- Der Planetentoni (Kempten 1904)
- Sieben heitere Volksspiele für die Vereinstheater in Stadt und Land (Regensburg 1904, 1912 erneute und um drei Stücke vermehrte Auflage).

Die Theatergruppe zur Aufführung "Die Kletzenwabm sei' Friedl"
aufgeführt im Jahr 1910
(Archiv für Heimatgeschichte Steinach)
Josef Schlicht - ein "Klassiker der bayerischen Volkskunde"
„Josef Schlicht – Klassiker der bayerischen Volkskunde“ – die Lehrerin Franziska Hager formulierte im Jahr 1927 als Erste diese Aussage im „Chiemgau“, die in der Folgezeit von vielen übernommen und weiterentwickelt wurde.
Als Teilgebiete der Volkskunde kommen heute insbesondere in Betracht: Haus, Arbeit und Gerät, Volkskunst und Realien, Kleidung und Tracht, Keramik, Möbel, Hinterglasbilder, Imagerie (d.h. in fabrikmäßiger Massenproduktion hergestellte Bilder jeder Art), Nahrung, Volksmedizin, Aberglaube, Volksfrömmigkeit, Brauchtum und Fest, Volksschauspiel, Volksmusik, Volkserzählungen, volkstümliche Lesestoffe, Soziales und Recht.
Schlichts Veröffentlichungen sind dabei den Volkserzählungen und den volkstümlichen Lesestoffen zuzuordnen. Mit dichterischer Sprachkraft ließ er Alltagspointen zur Volkspoesie geraten (Stefan Mohr). Schlicht hat seine Aufsätze und Bücher nicht für Gelehrte geschrieben. Sein Werk, wie er selbst sagt, „soll und will sein der ‚rechte treue Baiernspiegel’, aus dem das Volk herausschaut, wie es gestalten – wirklich lebt und leibt“.
Schon Martin Greif, der Schlichts Leistung für die Volkskunde der des unsterblichen Aventin auf dem Gebiet der Geschichte gleich stellte, riet: „Wer das altbayerische Volk kennenlernen will, wie es leibt und lebt, glaubt und liebt, freit und stirbt, der muss Schlicht lesen“.
Bis heute ist Schlichts Werk als Selbstdarstellung der bayerischen Seele unübertroffen. Kein Volk kann einen gleichwertigen Charakterspiegel von „kollektiver Gültigkeit“ aufweisen wie der bayerische Stamm (Rupert Sigl).
Schlicht als Heimatforscher und Historiker
Es muss ein unbeschreibliches Erfolgserlebnis für Josef Schlicht gewesen sein, als er am 9. Dezember 1878 nach langem Suchen in einem verstaubten Schrank im „Federnkammerl“ des Bauhauses das Steinacher Schlossarchiv entdeckte. Kurz zuvor hatte die Familienforschung den königlich-preußischen Oberst Hans Herwart von Bittenfeld nach Schloss Steinach geführt und er hat wohl den Steinacher Schlossbenefiziaten für die Geschichtsforschung begeistert.
Schlicht wertete nun systematisch die gefundenen Urkunden des Schlossarchivs und noch weitere hinzuerworbene aus, schrieb sie häufig vollständig ab und veröffentlichte seine Forschungsergebnisse in den Unterhaltungsbeilagen des „Straubinger Tagblatts“ der Jahre 1881 bis 1883 unter dem Titel „Steinach. Ein niederbayerisches Geschichtsbild von Joseph Schlicht“.
Schlichts 200-seitiges Manuskript wurde der Gemeinde Steinach im Jahr 2000 günstig zum Kauf angeboten und gehört heute zu den archivalischen und kulturellen Schätzen unserer Gemeinde. Manuskript und Unterhaltungsbeilage enthalten jedoch – entgegen der Überschrift – nur die Darstellung des Edelsitzes und der Pfarrei. Dorfschaft, Schlosskaplanei (Benefizium) und Schule sollten erst später dargestellt werden.
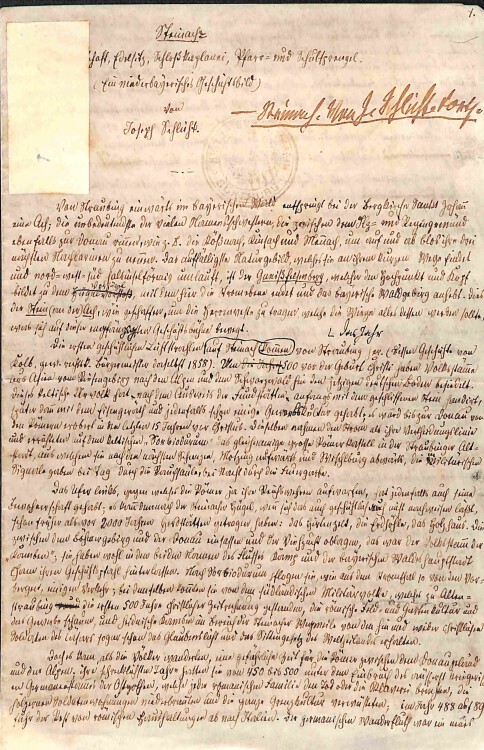
Seite aus dem Manuskript von Josef Schlicht mit Steinacher Geschichtsquellen für die
Unterhaltungsbeilagen des „Straubinger Tagblatts“, erschienen 1881 – 1883
(Archiv für Heimatgeschichte Steinach)
In den Jahresberichten des Historischen Vereins für Niederbayern in Landshut veröffentlichte Schlicht 1886 eine Kurzfassung der Unterhaltungsbeilagen, jedoch ergänzt um Benefizium, Schule und Dorf unter dem Titel „Steinach und dessen Besitzer“. Auch der Aufsatz „Zwei Herrschaften in Steinach“, veröffentlicht von Josef Schlicht in den Verhandlungen des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, Bd 7/1904, ist hier zu nennen.
1908 brachte Schlicht bei Attenkofer in Straubing das Buch „Die Geschichte von Steinach“ heraus, wobei er die weitere Entwicklung von Steinach bis zum Zeitpunkt der Herausgabe des Buches darstellte (z.B. auch den Bau des Neuen Schlosses), vieles aus den obigen Veröffentlichungen übernahm und ergänzte, manch Interessantes aber (z.B. die holländische Windmühle auf dem Kellerberg) aus Platzgründen wegließ.
„Die bündige Wahrheit“ nannte es Schlicht, als Abt Benedikt Braunmüller an seiner „Geschichte von Steinach“ „zu wenig wissenschaftliche Form“ fand. Und in der Tat, es fehlen wissenschaftliche Anmerkungen und Quellennachweise in dem Buch. Das Werk ist jedoch im Zusammenhang mit den Unterhaltungsbeilagen und dem wissenschaftlichen Aufsatz „Steinach und dessen Besitzer“ zu sehen. Dort sind im Text die Fundstellen angeführt, die Schlicht verwendet hat, insbesondere das später leider versehentlich verbrannte Steinacher Schlossarchiv. Der Steinacher Pfarrer Gerhard Mass ließ 1996 anlässlich der Primiz von Stefan Altschäffl einen Nachdruck der „Geschichte von Steinach“ in einem verkleinerten Format fertigen.
„Saulburg und seine Geschichte“ lautet ein Aufsatz von Josef Schlicht, den er im Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung im Bd. 3/1900 veröffentlicht hat.
Sein Buch „Niederbayern in Land, Geschichte und Volk“ ist die erste Monographie des bayerischen Unterlandes und sollte ein Pendant zum „Rheinhardstötter“ werden. In 34 Abschnitten behandelt das „Buch für Stadt und Land“ die Vorstufen, auf denen das Leben der Gegenwart erblüht. Richtig erkannte Schlicht die lange umstrittene Herkunft der Baiern: „Es waren mehrere Mischvölker, die sich früh und leicht zu einem einzigen Staatsvolke verschmolzen …. Die Bajuwaren bildeten den führenden Oberstamm“. Diese These des Mischvolks bestätigten die archäologischen Ausgrabungen im letzten Quartal des 20. Jahrhunderts, vor allem das Gräberfeld in Straubing, Bajuwarenstraße.
Der Stoff, den Schlicht bewältigen wollte, ist viel zu umfangreich, um auf 250 Seiten historisch entwickelt zu werden. Nach Rupert Sigl begnügt sich Schlicht sowohl bei seiner Geschichte von Steinach wie auch in seiner Geschichte von Niederbayern, damit, die Urkunden zu sammeln. In „Niederbayern in Land, Geschichte und Volk“ übernahm er die Forschungsergebnisse, wenn auch zumeist von zuverlässigen Forschern, und reihte sie ohne innere Kritik zu einem Mosaik zusammen. Dieser Versuch ist, wie auch Dr. Höpfl schon betonte, „nicht ganz gelungen“.In dem Buch erscheint auch eine Autobiographie von Schlicht selbst, auf die in der vorliegenden Arbeit immer wieder zurückgegriffen wird.
Mehr als zwölf Jahre betrieb Schlicht gezielte Geschichtsforschung, selbst in den Ferien, mühsam und unermüdlich in den weithin verstreuten Quellen und wälzte nebenbei, wie seine Notizen belegen, unzählige Arbeiten über bayerische Geschichte durch, um gelegentlich Rückschlüsse auf niederbayerische Verhältnisse zu ziehen. Ungedruckt blieb seine Arbeit über die „Kaiserkrone im Haus Wittelsbach“, die vom Verleger als „viel zu voluminös“ bezeichnet wurde, da „sie schon für sich fast ein kleines Buch bildet“. Nach Sigl scheint das Manuskript in unbekannte Hände gekommen zu sein.
Sigl bedauert Schlichts historisches Schaffen, denn dadurch sei die schöpferische Quelle verschüttet worden: „Er hat mindestens zwölf Jahre seines Schaffens an die Geschichtsforschung verschwendet, und darunter wurde seine schöpferische Quelle verschüttet …. Angesichts der Freiheit, die ihm die Herrschaft (Anm.: August von Schmieder) schenkte, ist es erstaunlich, wie wenige Geschichten er noch schreibt, obwohl sein Benefizium jetzt praktisch zu einer Sinekure geworden war und er bei den vielen Aushilfen ringsum viel neuen Stoff erfährt“.
Ehrungen für Josef Schlicht zu seinen Lebzeiten
In seinem 1908 erschienenen Buch „Die Geschichte von Steinach“ widmet Schlicht einen längeren Abschnitt auch dem „Benefizium Steinach“ und den verschiedenen Schlossbenefiziaten, damit auch seiner eigenen Person. Er geht auch auf die Ehrungen ein, die ihm bis dahin in Steinach zuteil wurden:
„Die Zeit in Steinach beschied ihm 2 Gedenktage. Das 50. Jahr seiner Ordination am 16. August 1906. Diesen Gedenktag gestaltete August von Schmieder für den Geistlichen in seiner Schlosskapelle zu einer vornehmen Festlichkeit. Nach der Kirchenfeier in der Sankt Georgskapelle war patronatsherrliche Festtafel in der Schlosshalle. Bei dieser umsaßen den Schlossherrn alle Gäste: Benefiziat Josef Schlicht von Steinach, Ökonomierat und Oberverwalter August Kuchenmeister von Puchhof, Verwalter Ludwig Niggl von Steinach, Kgl. Geistl. Rat und Anstaltspfarrer Josef Schneeweis und Klosterbeichtvater Georg Aichinger, beide von Straubing, Karmelitenpater Gerhard Wieselhuber von Sossau, Erzieher Dr. Isidor Feist aus Aschach an der Donau in Oberösterreich, die Pfarrer Johann Eichschmid von Parkstetten, Albert Lang von Steinach, Josef Hüttinger von Mitterfels, Adolf Stauber von Münster und Franz Hiendlmaier von Kirchroth, Benefiziumsverweser Max Plötz von Pilgramsberg, Sazellan Nikolaus Lechner von Falkenfels“.
Auf die Glückwünsche und ehrenden Zuschriften zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum antwortete Schlicht in der Zeitung:
„Wie nur so ein alter Tag solchen Rummel stiften mag!
Soviel Glückwünsch’, ernstlich, scherzlich,
Lieb und redlich, warm und herzlich,
Fast als wie ein Wolkenbruch
Für das bisschen Bayernbuch!
Frische Jahre, flotte Feder,
Neidlos, edel gönnt mir’s jeder,
Mündlich, brieflich, recht und treu,
Gar kein Falscher ist dabei!
Müßt’ zum Dank für all die Dinger
Stumpf mir schreiben meine Finger,
Heiser reden mich nicht bloß,
Nein – schon mehr noch, atemlos.
Für so was hat Riesenzunge,
Monsterstift und Juchtenlunge
Nur die Presse ganz allein.
Einzig der verbleib ich’s ein:
Spend Euch Gott wie mir das gleiche,
Eins nur nicht – die Klauenseuche!"
Steinach, 5. August 1906 Schlicht
Eine ganz besondere Ehrung erfuhr Schlicht ein Jahr darauf. Er schreibt darüber:
„Dem folgte am 13. Jänner 1907 das 50. Jahr seines öffentlichen Dienstantritts. Bei diesem Gedenktag erschien zu Steinach der Kgl. Bezirksamtmann Crusilla von Straubing und dekorierte den Benefiziaten mit der Ehrenmünze vom Kgl. Bayer. Ludwigsorden in Anwesenheit des Pfarramts, der Lehrerschaft, der beiden Verwaltungen von Gemeinde und Kirche und der Gutsverwaltung. Die Glückwünsche der Patronatsherrschaft trug der Fernsprecher aus dem Wintersitz in München nach Steinach“.
Ein Höhepunkt der kirchlichen Ehrungen war auch die Ernennung zum Bischöfl. Geistl. Rat im Jahr 1911.
Sogar vom König höchstpersönlich erhielt Josef Schlicht eine hohe Auszeichnung. Als am 10. Juli 1914 der bayerische König Ludwig III. Straubing besuchte, wurde Schlicht in den Rathaussaal befohlen. Hier erhielt Josef Schlicht den Michaelsorden IV. Klasse mit der Krone – in Silber – überreicht. Nichts ahnend war er gerade ganz ins Schauen vertieft – besonders interessierten ihn die Prinzessinnen -, als der König vor ihm stand, ohne dass er es bemerkte. „Hochwürden, nehmen Sie nur, er gehört schon Ihnen“. Mit diesen Worten musste ihn der König erst auf seine Person und auf die Auszeichnung, die ihm zugedacht war, aufmerksam machen, berichten uns L. Niggl und S. Höpfl.

Landesökonomierat Ludwig Niggl (1875 – 1971) – Nestor der deutschen Grünlandwirtschaft und Duz-Freund von Josef Schlicht
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach
Die Würdigung Schlichts in der heutigen Zeit
Schlicht wird in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts mehr und mehr zu einer Institution, er wird zu einem Begriff, d e r Schlicht, mit dem die Leute etwas anfangen können (Wax/Volksleben, 66). Schlicht findet in allen allgemeinen Büchern über den Landkreis Straubing-Bogen oder über Niederbayern Erwähnung.
1956 wurde ihm zu Ehren in der Steinacher Pfarrkirche eine bronzene Josef-Schlicht-Gedenktafel enthüllt, über jener Stelle, an welcher sich früher sein Grab befand. Die Tafel wurde von Studienrat F. Lankes entworfen. Oberlehrer O. Döring nahm die Enthüllung vor. Er gehörte mit Oberstadtschulrat Oberneder neben anderen zu den Initiatoren dieser Gedenktafel.

Oberlehrer Döring hält am 13. Mai 1956 die Gedenkrede bei der Enthüllung der Gedenktafel von Joseph Schlicht
Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Schlichts Grabmal in der Stenacher Pfarrkirche St. Michael
geschaffen von Franz Lankes
(Bild: Albert Lindmeier)
Die Tafel enthält neben einer Abbildung Schlichts folgende Zeilen:
GEISTLICHER RAT
JOSEPH SCHLICHT
*18.III.1832 +18.IV.1917
WIE KEINER KANNTE, LIEBTE UND SCHILDERTE ER
DAS ALTBAYERISCHE BAUERNLAND
1960 wird die Grundschule in Steinach nach Schlicht benannt. Ebenso erhalten in der Umgebung von Straubing, aber auch in München, Geroldshausen und anderswo, Straßen den Namen Schlichts. Seit 1977 wird die „Josef-Schlicht-Medaille“, an Personen verliehen, die sich um Heimat, Kultur und Brauchtum im Landkreis Straubing-Bogen verdient gemacht haben.
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts fand Schlicht zunehmend Aufnahme in wissenschaftlichen Schriften und allgemeinen Sammlungen bayerischer Autoren. Schlicht findet auch in Radiosendungen Erwähnung, so z.B. durch Rattelmüller in der Sendung „Boarischer Hoagascht“. Die Zunahme von Schlicht-Verweisen hängt nach Wax nicht zuletzt mit Bemühungen von Dr. Rupert Sigl zusammen, auf welche nachstehend näher eingegangen wird.
Gedenktafel für Josef Schlicht am ehemaligen Benefiziatenhaus
In der Ausgabe vom 28. April 1992 berichtete das „Straubinger Tagblatt“ unter der Überschrift „Steinach ehrt mit Bronzetafel Josef Schlicht“ Folgendes:
„Mit einem Festtag gedachte auf Einladung des Kulturkreises Josef Schlicht eine große Freundesschar des 75. Todestag des Klassikers der bayerischen Volkskunde, des Steinacher Schlossbenefiziaten und Kenners und Schilderers des bayerischen Bauernlebens der Jahrhundertwende. Zum Gottesdienst hatte der Musikverein Steinach-Münster mit seinem Singkreis und seinen Bläsern eine Auswahl von Liedern und Instrumentalstücken getroffen, die so recht in den Geschmack der bayerischen Seele trifft. In seiner Begrüßung stellte Ortspfarrer Gerhard Mass seine Mitbrüder vor, zum einen BGR Ludwig Dotzler, auf dessen Anregung hin der Schlichtgedanke zustande kam, dann Dr. Karl Hausberger, Professor für Kirchengeschichte des Donauraumes, welcher schließlich die Predigt hielt“.
Im Rahmen eines Festaktes wurde an dem in vorbildlicher Weise von seinen jetzigen Besitzern, Prof. Dr. Thomas und Ursula Grundler, sanierten Wohn- und Sterbehaus des Benefiziaten Josef Schlicht eine Erinnerungstafel enthüllt. Die vom ehemaligen Steinacher Pfarrer Ludwig Dotzler gestiftete und von dem Straubinger Künstler Walter Veit-Dirscherl entworfene Bronzetafel wurde vom Vorsitzenden des Kulturkreises Karl Penzkofer vorgestellt. Sie trägt folgende Inschrift: „Hier lebte und starb Josef Schlicht, Schlossbenefiziat von Steinach, 1871 – 1917“. Der Stifter BGR Ludwig Dotzler führte aus: „Diese Gedenktafel drückt in ihrer ehernen Art die Wertschätzung aus, welche dem Steinacher Schlossbenefiziaten in seinem Heimatort entgegengebracht wird“. Der Volkskundler Professor Dr. Walter Hartinger sprach im Anschluss an die Feier zu dem Thema „Probleme einer geistigen Dorferneuerung“.
Dr. Rupert Sigl - ein großer Schlicht-Kenner
Zwei Autoren haben sich bisher mit Josef Schlicht und seinem Werk am intensivsten befasst: Dr. Rupert Sigl und Johann Wax.
Dr. Rupert Sigl, einst Kulturredakteur am „Straubinger Tagblatt“, hat sich eingehend mit Schlicht beschäftigt und ist der große Schlichtkenner schlechthin. Sein halbes Leben hat er sich mit Leben und Werk von Josef Schlicht befasst. Von besonderer Bedeutung für die Schlicht-Forschung ist die Biographie, für die er auch Quellen aus dem ihm gehörenden Schlicht-Nachlass verwendete: „Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel – Eine Einführung in Leben und Werk des Klassikers der bairischen Volkskunde“, Rosenheim 1982. Im ersten Teil seines Buches geht Sigl ein auf Heimat und Kindheit, Jugend und Bildung, Schlichts Zeit als der „Kloa Herr“, d.h. Kooperator in Oberschneiding sowie auf den Schriftsteller. Den zweiten Teil widmet Sigl dem Dichter und Volkskundler sowie Schlichts Zeit- und Gesellschaftskritik und Schlichts Nachleben. In zahlreichen Artikeln in Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Kalendern hat Sigl das Werk des Steinacher Schlossbenefiziaten Josef Schlicht dargestellt und gewürdigt. In dem von ihm herausgegebenen Buch „Blau Weiss in Schimpf und Ehr“ bringt er verschiedene Erzählungen von Josef Schlicht aus dessen Veröffentlichungen und aus dessen Nachlass einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis.
Sigl geht auch auf Schlichts literarische Darstellungsweise ein: „Und all das und unendlich viel mehr hat der Schlossbenefiziat nicht in einer strohtrockenen Art wie ein Volkskundler geschildert, sondern eben ‚gestaltenwirklich’, erlebt. Und daran hängt heute unser großes Interesse, weil Schlicht Menschen, verliebte und leidende, Herren und Knechte, in ihrem Alltag darstellte, in ihrer Arbeit und Freude, in ihrer Krankheit und ihrem Übermut, kurz das ‚ganze Volksleben’“.
Den zweiten Teil seines Buches nennt Sigl „Der Dichter und Volkskundler“.
In mehreren Passagen weist Sigl darauf hin, dass Schlicht „mehr ein gestaltender Künstler“ ist. Die Sprache habe eine ungeheuere Bildkraft und Farbigkeit, vor der sich der Volkskundler wie farbenblind vorkommen müsse. Die bajuwarisch-barocke Überladung mit Verben habe nichts mehr mit der Wissenschaft vom Volke zu tun.
„Hier flirtet und spielt, tändelt und scherzt einer mit der Sprache, wie nur ein Verliebter es kann, der sich selbst nicht mehr kennt, sondern einfach von seinen Phantasien mitgerissen wird. Ecce poeta! Seht den Dichter am Werk, den gestaltenden Künstler, dem das ‚Bilde, Künstler ! Rede nicht !’ zum Schicksal geworden ist, ihn selbst übermächtigt hat“. Nach Sigl ist das Aneinanderreihen für Schlichts Stil charakteristisch. Es offenbart uns sein leidenschaftliches Spiel mit den Worten, um die Wirklichkeit des Lebens einfangen zu können. Wie mit den Verba versuchte er es auch mit Adjektiven und Substantiven: „Der Stadtprediger war der seine, dem er zweistundenweit zuruderte ‚durch Sonnenglut und Bärenkälte, Schneewehen und Glatteis, Staubwolken, Wetterblitz und Landschwemmen’“. Ein weiteres Beispiel führt Sigl an: „Der Lenz, der sich seinen Lieblingsschmaus in der Stadt gekauft hat, ihn aber ungenießbar findet, verliert seine heitere Laune, setzt sein entschlossenstes, pelzigstes, fuchtigstes, wildestes, grimmigstes Gesicht auf, richtet sich noch ein drittes und letztes Mal zum Zugreifen und schielt dabei in seine Mahlzeit hinein: ‚Kaffd hob öh döh; zoihd hob öh döh; und frößn duar öh döh jetzt schon ah, geht’s wöi’s mog’“.
Weiter führt Sigl aus:
„Ein sicheres Merkmal, an dem wir den Dichter erkennen können: Das Wort ist ihm keineswegs Hauptzweck. Die aufmerksamkeitheischenden Neuprägungen treten in seiner Schilderung so ganz ohne Zwang und unauffällig auf und beweisen, dass der Schriftsteller sie nicht einmal gesucht hat. Wieder ein Grund mehr, in ihm einen Dichter zu sehen, der an der Form nicht mühsam meistern muss. Darum kommt bei ihm auch der Stoff als solcher restlos zur Geltung. Und dieser Stoff ist immer der Mensch und nur der Mensch. Nicht, dass er achtlos an dem Zauber der Natur vorübergegangen wäre: manch ein kurz hingeworfenes Wort lässt uns ahnen, dass er gar gut zu lesen verstand im Buch der Schöpfung. Aber sein erstes und letztes Interesse gilt dem Menschen und allem was ihn seelisch bewegt“.
Die kritische Magister-Arbeit von Johann Wax - Versuch einer Rezension
In jüngerer Zeit hat sich Johann Wax in seiner Magisterarbeit mit dem Thema „Die Darstellung des Volkslebens bei Joseph Schlicht und ihre Wirkungsgeschichte“, vorgelegt 1986 am Lehrstuhl für Volkskunde der Universität Regensburg, wissenschaftlich mit Josef Schlicht und seinem Werk auseinandergesetzt (im Folgenden zitiert: Wax , Schlicht/Volksleben).
Er beleuchtet in seiner sehr fundierten Arbeit kritisch Schlichts Werdegang vom Hüterjungen zum volkskundlichen Literaten. Wax gliedert seine Arbeit in zwei Teile. Im ersten Teil stellt er den Aussage- und Quellenwert von Schlichts Werk auf dem geistesgeschichtlichen und wirtschaftspolitischen Hintergrund des 19. Jahrhunderts vor. Der zweite Teil der Arbeit vermittelt den Rezeptionsstrang des Schlichtschen Werks. Dabei arbeitet er eine Interessensgruppe heraus, der die Schlicht-Forschung seiner Meinung nach von Beginn an ein Anliegen war, wobei er das wandelnde Interesse dieser Gruppe analysiert. Nach Schlichts Biographie, wendet sich Wax der Interpretation der Erzählungen Schlichts zu. Zur Interpretation zog er die Erzählungen „Der Blitz in die Grenzfichte“, „Die brave Plendlbäuerin“ und „Der ehrbare Seniorbauer“ heran.
Nach Wax gebraucht Schlicht einen ausgeprägten Adjektiv-Stil, dargestellt an Hand der Erzählung „Der Aumer von Gmünd“: „seebreite Donau“, „allernächster Nachbar“, „sauerstoffreicher tiefschattiger Konzerthain“. Durch solche Zusammensetzungen schaffe Schlicht oft assoziationsreiche Wortballungen, die durch Vergleiche und Bilder in ihrer Stimmungserzeugung noch unterstützt werden: „wie ein Laubeiland im Meer“, „wie ein versteinerter Strom“, „als schön geschnittener Kegelberg“. Verbindungen und Reihungen von Substantiven helfen nach Wax diese stereotyp überhöhte Landschaftbeschreibung zu untermalen: „Weizen-, Korn- und Gerstenfelder“. Mit der abschließenden Bezeichnung der Landschaft als „Paradies“ wird die religiöse Überhöhung der Welt, in der der Bauer lebt, deutlich. Die Stadt erscheine gegenüber der Landschaftsbeschreibung eindeutig im negativen Licht. Diese stadtfeindliche Haltung Schlichts sei latent vorhanden. Von „den neumodischen christentumslosen frechen Pflasterzeisigen“ und vom „gottfeindlichen Stadtvolk“ ist die Rede. Die bäuerliche Welt und die bäuerliche Hierarchie ist für Schlicht in Ordnung und wird für gut befunden. So stellt Schlicht die Sitzordnung im Wirtshaus durchaus positiv dar: Großbauer, Mittelbauer, Kleinbauer, Großsöldner, Mittelsöldner, Kleinsöldner, Gütler, Häusler und Leerhäusler sitzen getrennt voneinander auf den ersten fünf Tischen. Am sechsten Tisch endlich sitzen die durchziehenden Schnapsbrüder, Zigeuner, Schnallendrücker, Buttenträger, Gänstreiber, Mausfallenhändler, Bilderpritscher (=Jahrmarktshändler). Die Methoden, die Schlicht den Bauern – sollte die Hierarchie einmal gestört sein – zubilligt, um diese wieder herzustellen, tragen zum Teil menschenverachtende Züge. So verweist Wax auf die Erzählung „Der bayerische Oberknecht“; wo die Hofhierarchie durch Prügel aufrechterhalten wird.
Der Bauer steht nach Wax im Mittelpunkt von Schlichts Betrachtungen, vor allem der Großbauer. Charakterköpfe sind fester Bestandteil seiner Erzählungen. Dabei verwendet er gern die Attribute „brav, ehrenbrav, altbayerisch, blauweiß“. Nach Wax werden die Personen der Erzählung als religiöse Menschen dargestellt. Die Attribute für den „Seniorbauern“ veranschaulichen das: „echter katholischer Kernbayer“, „der ehrenbrave wie christlich-frohsinnige Senior“, „schneidiger Berufsernst und christliche Tatkraft“. Auch in der Leitung seines Hofes handelt der Bauer nach streng christlichen Grundsätzen: „Sein zahlreiches Untertanenvolk (…) nahm er sofort in gebührend strenge Christenordnung“, „in Hausandacht, Familienfrömmigkeit, Kircheneifer (…) war er den Seinigen allein ein lebendiges Vorbild und Beispiel“.
Zweck der Erzählungen liegt nach Wax klar in der Vorbildhaftigkeit der dargestellten Personen. Es handelt sich durchwegs um Moralgeschichten, die das Beispielhafte des Dargestellten vermitteln sollen (Wax, Schlicht/Volksleben, 25). Nach Wax beschränkt sich Schlichts Darstellung von Volksleben auf den Bauern. Dies lasse sich wiederum einschränken auf eine gehobene Schicht von Bauern, lediglich Groß- und Mittelbauern seien zur Darstellung gelangt. Andere soziale Dorfschichten fänden über Erwähnungen hinaus keine Beachtung. Soziale Spannungen seien kein Thema der Erzählungen. Es werde lediglich eine bäuerliche Idylle gezeigt. Wax verweist auf K.S. Kramer, der betont, dass dem „scharfen Beobachter Schlicht“ die widrigen Zeitumstände und die sich immer stärker andeutende Industrialisierung und Technisierung nicht verborgen bleiben konnten. Kramer kritisiere, dass Schlicht soziale Konflikte ausspare und den Wandel der Zeit, der gerade die Bauernschaft anging, nicht thematisierte. D. Bayer spreche von „Zwangsharmonisierung“. Dem Leser werde das Traumbild einer Wirklichkeit vorgegaukelt, die es gar nicht gebe. Nur das Schöne werde sichtbar; alles was wirklich, natürlich und darum auch einmal schwer oder unangenehm sein könnte, werde unterschlagen. Auch K.A. Mayer schließe sich dem an und betone, dass Schlicht viel von unsittlichen Zuständen in Bayern verschweige, dass er eine „mittelalterliche Insel“ schildere, die abgehoben sei von der realen Welt. Volksleben unterliege bei Schlicht einer starken Idealisierung. „ Wer idealisiert, verklärt die Wirklichkeit mit Werten, die ihr nicht entsprechen“. Nicht mehr der Bauer und seine Arbeit sind Gegenstand der Darstellung, „sondern die in die bäuerliche Welt projizierte Vorstellung des Dichters“.
Weiter führt Wax aus:
„Als wichtige Komponente, die Schlichts Bauern ausmacht, zeigt sich die Religion. Schlicht propagiert den christlich-katholischen Bauern …. Der Beruf des Bauern erscheint als göttliche Bestimmung. Wird dieser göttlichen Berufung gefolgt, ist der Erfolg im Leben und Beruf gesichert, anders nicht – so Schlicht. Die ausschließliche Darstellung von reichen Bauern scheint dies zu untermauern ….
Schlichts Volksleben stellt jedoch eine statische Welt dar, die keinen Bezug zur Gegenwart hat. Darin äußert sich ein stark konservativer Zug, eine „Obedienzgesinnung“, die letztlich konservative Kreise seiner Zeit unterstützten und nichts zur Lösung wirklicher Probleme des Bauernstandes beitrugen.
Soweit kann die Arbeit von Johann Wax als durchaus fundiert und gut recherchiert eingeordnet werden. Seine weiteren Thesen aber können nicht unwidersprochen hingenommen werden.
Josef Schlicht - Nazi-Vorläufer und Antisemit?
Johann Wax kommt auf Grund seiner Überlegungen zu weiteren bemerkenswerten Schlussfolgerungen und Behauptungen:
- „Das Volksleben unterliegt bei Schlicht einer starken Idealisierung (Wax, 31). Schlicht hat germanische Mythologie in sein Werk eingebracht. Das führt zu der Gleichung nordisch = germanisch = bäuerlich. Bauerntum und Bauernmythos werden hochgehalten (Wax, Schlicht/Volksleben 33,34). Schlicht ist mit dem Inhalt seiner Erzählungen zu dem Vorbereitungsstrang nationalsozialistischer Ideen zu zählen ….
Die Analyse seiner Texte hat deutlich ergeben, dass sich von Schlicht vertretene Ideen … typisch für das 19. Jahrhundert waren, bei den Nazis wieder finden, dort eigentlich erst recht kultiviert werden“. - „Auffallend antisemitische Haltung“?
Wax führt auf S. 18 und 78 weiter aus:
“Schlicht schildert normalerweise funktionierende Bauernwelt. Störer oder Feinde finden sich sowohl in der Hof- wie in der Dorfhierachie. Es sind ‚lässige Knechte’, ‚böse Dorfrangen’, ‚auswärtige Strolche’. Neben diesen Störern allgemeiner Art taucht auch der Jude als spezieller Gegner bäuerlichen Lebens auf. Schlicht schildert ihn ziemlich drastisch als geldbesitzenden Wuchere…. ‚Jude’ taucht oft in diffamierenden Zusammensetzungen auf: ‚Geldjuden’, ‚Judenschludbuch’ (Wax, Schlicht/Volksleben, 18)“.
Weiter ergänzt Wax:
“Darüber hinaus äußern sich in Schlichts Bauerndarstellungen pangermanische Ideen, die – mit einer auffallend antisemitischen Haltung gepaart – national–sozialistisches Gedankengut bereits vorwegnehmen“. - Die Lehrerschaft als die Triebfeder der Schlicht-Verherrlichung.
Die „Konservierung“ Schlichts durch die Lehrerschaft (Wax, Schlicht/Volksleben, 78 ff.) wird hingehend behandelt.
Wax führt einleitend aus: „… die Ergebnisse von Heimatforschung sind dazu geeignet, Machtverhältnisse zu festigen“.
Weitere Aussagen von Wax in Stichworten:
“Über den Schulbereich wird hier zum Teil schon Kindern falsche Tradition als Identifikation angeboten“.
“Von obrigkeitlicher Seite vereinnahmt hat die solcherart gepflegte Kultur unter anderem die Funktion, in der vernachlässigten Provinz, die ‚Jahr für Jahr die beifallsseelige Kulisse’ für politische Veranstaltungen abgeben darf, die frustrierende wirtschaftspolitische Gegenwart abzudämpfen und mit dem Bild einer besseren Vergangenheit von dieser abzulenken“.
“In diesem Rahmen leistet Schlicht durch seine Darstellung von Volksleben – fleißig verbreitet und aufpoliert von Lehrern – seinen Beitrag, erweist sich als nicht so schlicht“.“
… doch kann Heimatforschung nach wie vor konkretes Aufstiegsmittel sein, da bei aufstiegswilligen Lehrern geprüft wird, ob sie etwas veröffentlicht haben“.
Kritisch geht Wax auch auf die „Heimatkundliche Stoffsammlung“ der bayerischen Volksschulen ein.
Eine Ehrenrettung für Josef Schlicht
Die von Wax wissenschaftlich ermittelten Fakten können nicht bestritten werden. Doch kommt Wax in seiner Interpretation zu Schlussfolgerungen, die nicht unwidersprochen bleiben dürfen.
Zu 1: Schlichts Bauerndarstellung als Vorbereitungsstrang nationalsozialistischer Ideen.
Wax konnte in einem Gespräch mit dem Steinacher Josef Altschäffl, geboren 1901 und vier Jahre lang Ministrant bei Schlicht, in Erfahrung bringen, dass Schlicht in Gesprächen mit den Leuten viel erfahren hat, was er dann in seine Erzählungen verarbeitete. Diese ist ein Hinweis dafür, dass Schlicht nicht nur fabulierte, sondern seine Eindrücke durch unmittelbare Befragungen gewonnen hat.
Dass Schlichts Bauerndarstellung nicht als „Vorbereitungsstrang nationalsozialistischer Ideen“ in Betracht kommt, zeigt Wax an anderer Stelle selbst auf: „Schlichts“ Darstellung vom Bauern zeigte vermutlich eine für die Nazis zu starke religiöse Komponente, so dass sie nicht in dem Maße für ihre politischen Zwecke verwertbar war“ (Wax, Schlicht/Volksleben, 61). Damit widerlegt Wax selbst seine oben genannte These.
Ich darf in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass Schlicht keine wissenschaftliche Arbeit der Volkskunde schreiben wollte (obwohl er dazu befähigt war). Prof. Angelus Sturm führt dazu aus: „Kaum ein Blatt findet sich in seinen Büchern, das ihn nicht als Dichter verriete“. Sein Stil, seine Charakterisierung der bayerischen Mentalität, seine Schilderung des Volkslebens, die Generationen überdauern wird, verrät uns mehr den gestaltenden Künstler als den nüchternen Gelehrten“.
Mit diesen Fragen beschäftigt sich in jüngster Zeit Prof. Dr. Karl Hausberger, Universität Regensburg (vgl. 10. Forschungsbericht der Universität, veröffentlicht im Internet). Das Forschungsthema lautet: „Dorfidylle contra Großstadtfeindlichkeit? Leben und Werk des religiösen ‚Volkskundlers’ Josef Schlicht (1832 – 1917)“. Hausberger untersucht, ob Schlicht in seinen Werken, namentlich im vielgerühmten Buch „Bayerisch Land und Bayerisch Volk“ von 1875, tatsächlich ein realitätsnahes Bild vom bäuerlichen Leben und volksfrommen Brauchtum im Niederbayern des 19. Jahrhunderts zeichnet oder ob es ihm in der Gefolgschaft von Wilhelm Heinrich Riehl in erster Linie darum geht, ein idealisiertes Landleben gegen die moderne Industriekultur auszuspielen. Prof. Hausberger führt weiter dazu aus: „Dieser Frage gilt das Hauptinteresse der Untersuchung seines literarischen Oevres mit dem Ziel, erstmals eine kritische, auch auf ungedruckten Quellen fußende Biographie Schlichts vorzulegen. Außerdem ist die Veröffentlichung einer Anthologie seiner teilweise nur mehr schwer zugänglichen Mileuskizzen geplant. Das schon im Forschungsbericht 2003 benannte Projekt, musste zurückgestellt werden, weil der im Privatbesitz befindliche Nachlass Schlichts nicht zugänglich war. Zwischenzeitlich ist dieses Problem behoben“. Dem Ergebnis dieser Forschungen wird mit Interesse entgegengesehen.
Schlicht wegen seiner vielleicht zu blumigen Schilderungen des bäuerlichen Lebens – wie Wax meint – zum „Vorbereitungsstrang nationalsozialistischer Ideen“ zu rechnen, halte ich für abwegig.
Zu 2: Die Darstellung Schlichts als Antisemit
Am Beispiel der „Geschichte von Steinach“ ist Schlichts Grundeinstellung zum Thema „Juden“ gut erkennbar. Schlicht übt dort Kritik am Finanzgebaren der früheren Steinacher Schlossherrschaften („Allein nach diesen Baujahren 1737 – 1739 erscheint in der Gutsrechnung von Steinach wieder Dolnsteiner, der herwartische Wechseljude“, Die Geschichte von Steinach, S.34). Schlicht wollte hier in erster Linie die Verschwendungssucht des Adels anprangern, die zu ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt hatte. Der Steinacher Adel besorgte sich häufig die nötigen Mittel für seine oft verschwenderischen Bedürfnisse durch Schuldaufnahme bei jüdischen Geldverleihern. Banken und Sparkassen gab es ja damals in unserem Raum noch nicht.
Bei größeren Projekten, die der Fremdfinanzierung bedurften, kamen in beschränktem Ausmaß kirchlich Institutionen wie Bruderschaften in Betracht, vor allem aber gewerbliche jüdische Geldverleiher, die als Nichtchristen Zinsen verlangen durften, wegen der fehlenden Sicherheiten und des hohen Ausfallrisikos aber hohe Zinssätze verlangen mussten. Obwohl man ihn dringend brauchte, war der geldgebende Jude oftmals nicht sehr geschätzt; mussten doch die Schulden mit Zins und Zinseszins termingerecht zurückgezahlt werden. Vor diesem Hintergrund sind manche Judenprogrome im Mittelalter zu sehen, verbrannten mit den Juden doch auch die Schulden!
In diesem Zusammenhang sei auf Schlichts genossenschaftliches Engagement hingewiesen, das bisher literarisch kaum gewürdigt wurde. Im März 1905 wurde der Darlehenskassenverein Steinach gegründet, der später durch Fusion in der heutigen Raiffeisenbank Parkstetten aufgegangen ist. Bankdirektor Josef Murr führt dazu in der Festschrift zur Einweihung des Raiffeisenbankgebäudes Parkstetten im Jahre 1983 Folgendes aus: „Schriftführer des jungen Vereins war kein geringerer als der damalige Steinacher Schloßbenefiziat Josef Schlicht. Gerade von ihm mag auch ein gerüttet Maß an Initiative zur Gründung des Darlehenskassenvereins Steinach ausgegangen sein…. Der berühmte Schloßbenefiziat war überzeugter Anhänger und Mitglied des Bayerischen Bauernbundes. Solchermaßen mit der Mentalität, aber auch mit den Sorgen und Nöten der bäuerlichen Bevölkerung vertraut, darf Schlicht zugetraut werden, dass er für den Verein gerade in seinen Anfängen ein besonders wertvoller Mann war, zumal er als Eisenkopf galt, der es verstand, sich durchzusetzen …. Die erste Generalversammlung nach der Gründung des Darlehenskassenvereins Steinach fand am 20. August 1905 statt …. Diese Eintragungen stammen von Josef Schlicht, der ein sehr fleißiger Mann gewesen zu sein scheint, den er stellte zum Ende eines jeden Monats einen so genannten Monatsabschluß zusammen. Er wird im Jahre 1907 auch als Stellvertreter des Vorstandes genannt“.
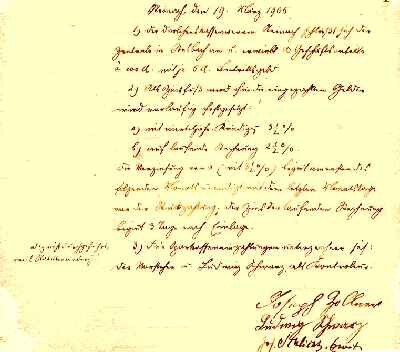
Erster Eintrag im Vorstands-Protokollbuch des neugegründeten Darlehenskassenvereins Steinach vom 19. März 1905.
Als Drittunterzeichneter ist zu erkennen „Jos. Schlicht, Benefiziat“. Josef Schlicht ist bis zu seinem Tod im Jahre 1917 Mitglied der Vorstandschaft
(Mit freundlicher Genehmigung der Raiffeisenbank Parkstetten)
Schlicht ist von seiner Erziehung und Ausbildung her ein integrer Charakter, der sittliche und moralische Werte sehr hoch ansiedelt. So gilt seine Kritik nicht dem Adel als solchen, sondern der Verschwendungssucht desselben, den er aus Steinacher Archivakten feststellen konnte. Schlicht wendet sich auch nicht gegen das Judentum, sondern gegen den „Wucherer“. Kurz gesagt: Schlicht verurteilt die beiden menschlichen Laster „Verschwendungssucht“ und „Habgier“. Er muss diese Laster schon von seiner priesterlichen Ausbildung und seinem Berufungsauftrag her anprangern und versuchen, die Menschen zu Besserem zu bekehren.
Sicher ist auch Schlicht ein Kind seiner Zeit. Er musste mit ansehen, wie mancher Bauernhof überschuldet war und von den Geldgebern (auch jüdischen) zur Versteigerung getrieben wurde. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er dies bemitleidet und verurteilt. Diese Einstellung ist auch heute oftmals noch gegenüber den Banken anzutreffen, wenn diese mangels Zahlungsfähigkeit des Kunden zur Verwertung seines Vermögens gezwungen sind.
Zu 3: Die Lehrerschaft als „Konservator“ von Josef Schlicht
Wax betritt hier ein gesellschaftspolitisches Gebiet. Die Aussagen dazu haben mit der Person „Josef Schlicht“ und seinem Werk im engeren Sinn nichts zu tun.
Sie betrifft vielmehr eine später einsetzende Entwicklung und ist für die vorliegende Darstellung nicht relevant. Sie darf auf die Person „Josef Schlicht“ nicht in einem negativen Sinn zurückprojiziert werden.
Schlusswort
Josef Schlicht hat 46 Jahre in Steinach gelebt und gewirkt.
Hier in der Beschaulichkeit der Vorwaldgegend, geschätzt und beliebt bei der Schlossherrschaft, dem heimischen Klerus und zahlreichen Freunden und Lesern, fand er das geeignete Umfeld für sein literarisches Wirken und seine Forschertätigkeit. Seine Arbeit wird in höchsten Fachkreisen anerkannt und gewürdigt.
Er wird sogar von Spindler in seinem mehrbändigen „Handbuch der Bayerischen Geschichte“, einem bedeutenden Standardwerk und im „Lexikon für Theologie und Kirche“, herausgegeben von Michael Buchberger, erwähnt.
Steinach verdankt Josef Schlicht vor allem seine Forschungen zur Steinacher Geschichte und deren Veröffentlichung. Zu Recht kann Josef Schlicht als „Steinacher“ bezeichnet werden und zählt zu den Berühmtesten unter den Steinacher Bürgern. Die Gemeinde Steinach wird ihrem hervorragenden Sohn stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Quellennachweis in Auswahl:
Agsteiner, Hans, Steinach, Eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, Straubing 1996, Biographische Angaben, 112 ff. Geschichten von Josef Schlicht aus dem Gemeindebereich, 393 ff.
Gebhard, T., Volkskunde in Bayern, in: Roth/Schlaich (Hrsg.), Bayerische Heimatkunde, München 1974
Murr, Josef, Festschrift zur Einweihung des Raiffeisenbankgebäudes Parkstetten im Jahre 1983
Schlicht, Josef, Die im Text dieser Arbeit genannten Werke, zum Teil in Neuauflagen
Schlicht Manuskript, von Gemeinde Steinach erworben, veröffentlicht in: Gemeindebote Steinach, Ausgabe September 2000
Sigl, Rupert, Josef Schlicht – Der rechte treue Baiernspiegel, Eine Einführung in Leben und Werk des Klassikers der bairischen Volkskunde
Wax, Johann, Die Darstellung des Volkslebens bei Joseph Schlicht und ihre Wirkungsgeschichte, Magisterarbeit eingereicht bei der Universität Regensburg, Philosophische Fakultät IV, Sprach- und Literaturwissenschaften, Lehrstuhl für Volkskunde Prof. Dr. Konrad Köstlin, im September 1986
Weigert, Josef, Erinnerung an den Schlossbenefiziaten Joseph Schlicht, „Straubinger Tagblatt“, Erscheinungsdatum unbekannt
August von Schmieder
von Dr. Thomas Grundler
1901 beginnt die Geschichte der Familie von Schmieder in Steinach mit dem Kauf des Schlossgutes Steinach durch Dr. jur. Karl August Schmieder, 1963 endet sie mit dem Verkauf durch seinen Sohn Dr. Max von Schmieder.
Gut 60 Jahre, die bis heute Ortsbild, Bedeutung und Bekanntheitsgrad von Steinach wesentlich bestimmen.

Zur Herkunft der Familie von Schmieder
Karl August Schmieder wird am 29.Mai 1867 in Breslau als einziges Kind der Eheleute August Schmieder (1824 - 1897) und Paula Schmieder (1827 – 1897) geboren. Beide Eltern stammen aus Karlsruhe, wo sie in der Langen Strasse eine vom Schwiegervater übernommene Brauerei betreiben, die allerdings 1850 Konkurs anmelden muss1. August und Paula Schmieder übersiedeln nach Schlesien, wo August Schmieder „wegen seiner außerordentlichen Tüchtigkeit“ - wie Joseph Schlicht in seiner Geschichte von Steinach bemerkt – zum Generaldirektor und Teilhaber der „Schlesischen Aktiengesellschaft für Bergbau“, die neue Zinkhütten, Walzwerke, Kohlen- und Galmeigruben in Lipine, Ohlau und Jedlice betreibt, aufsteigt2,3. Zu guter Letzt fungiert er zudem als Bankier in Breslau1.

August Schmieder (1824-1897) und Pauline Schmieder (1827-1897)
Der Zinkbergbau erlebt in Schlesien in dieser Zeit einen gewaltigen Boom, 1876 produziert Schlesien schon mehr als die Hälfte des gesamten in Deutschland erzeugten Zinks.1881 kehrt August Schmieder mit seiner Familie als sehr vermögender Mann nach Karlsruhe zurück und errichtet in der Karlsstrasse 10, wie man in der Beschreibung des Palais der Stadt Karlsruhe lesen kann, „um sein früheres Scheitern vergessen zu machen das verschwenderisch ausgestattete Palais Schmieder“4. Die Baukosten dieses, vom berühmten Architekten der Karlsruher Gründerzeit Baurat Josef Durm, Professor an der Technischen Hochschule Karlsruhe, geplanten, prunkvollen Gebäudes im Herzen von Karlsruhe belaufen sich auf fast 1,2 Mio. Goldmark. Ein auch für heutige Verhältnisse ungeheuerlicher Betrag für ein Privathaus (nach heutiger Kaufkraft etwa 12 Mio. Euro). Die hohe Bausumme kommt vor allem auch deswegen zusammen, da August Schmieder namhafte Künstler mit der Gestaltung der Außenfassade und der Ausstattung der Innenräume beauftragt. Natürlich erhält das große Haus ein Dach aus schlesischem Zinkblech.

Villa Schmieder in Karlsruhe um 1884
Quelle: Stadtarchiv Stadt Karlsruhe
August und Pauline Schmieder, versterben beide im April 1897 „nach einem besonders herben Winter“ innerhalb von 4 Tagen. Im Nachruf in der „Karlsruher Zeitung“ wird August Schmieder als der „reichste Mann“ von Karlsruhe bezeichnet1. Das Erbe tritt als einziges Kind ihr Sohn Dr. jur. Karl August Schmieder an, zu der Zeit Assessor in Frankfurt am Main. 1899 erwirbt Prinz Max von Baden anlässlich seiner Vermählung mit Prinzessin von Cumberland; der Herzogin von Braunschweig-Lüneburg das Palais. Seitdem spricht man in Karlsruhe vom „Prinz Max Palais“, das später in den Besitz der Stadt Karlsruhe übergeht. Im 2. Weltkrieg nach einem Bombentreffer ausgebrannt, wird es wieder aufgebaut und dient von 1951 – 1969 als Sitz des Bundesverfassungsgerichtes, heute beherbergt es Teile des Karlsruher Stadtmuseums4.
Dr. jur. Karl August von Schmieder
Karl August Schmieder besucht zunächst das Gymnasium in Karlsruhe, studiert anschließend Jura in Heidelberg, Frankfurt und Breslau, promoviert in Berlin zum Dr. jur. und macht in Frankfurt sein Assessorexamen2. Als beide Eltern 1897 sterben, erbt Dr. Karl August Schmieder mit 30 Jahren das außerordentlich große Vermögen seines Vaters, das in einem Zeitungsartikel der „Karlsruher Zeitung“ vom 19. April 1951 auf 60 Millionen Goldmark geschätzt wird1, heutiger Kaufkraft nach in etwa 600 Mio. Euro!

Karl August von Schmieder um 1901
Seine Begeisterung für die edlen Vollblutpferde und den Galopprennsport bringen Karl August Schmieder irgendwann um das Jahr 1885 in Frankfurt mit Carl von Lang-Puchhof, zusammen, den in seiner Zeit erfolgreichsten Galopprennpferdezüchter Bayerns, der auch in Frankfurt einen Wohnsitz hat. Carl von Langs Vater macht als Leitender Ingenieur beim Bau der „Bayerischen Ostbahnen“ und beim Bau des türkischen Teiles der Bagdadbahn ein Vermögen, das er an seine Söhne Carl und Herrmann vererbt. Beide Söhne werden anstelle des plötzlich versterbenden Vaters von Ludwig II. „in Anerkennung der Verdienste des Vaters um den Aufbau der Bayerischen Ostbahnen“ 1885 in den erblichen Adelsstand erhoben5. Carl von Lang-Puchhof wird später von der Krone sogar zum „Erblichen Reichsrat der Krone Bayerns“ ernannt. Er erwirbt 1870 Gut Puchhof6 und errichtet in einem weitläufigen, ca. 50 ha(!) großen Park das „Neue Schloss Puchhof“ und im benachbarten Aholfing ein Vollblutgestüt (heute Gut Aholfing von Familie Helmut Lang, Namensgleichheit zufällig).
Carl von Lang-Puchhof und Karl August Schmieder unterhalten gemeinsam von 1898 bis 1907 einen Rennstall in Berlin-Hoppegarten und züchten im Gestüt in Aholfing Vollblüter. 1899 gewinnen „Hut ab“ mit dem Preis der Diana und „Hagen“ mit dem Preis des Winterfavoriten für die Besitzergemeinschaft Carl von Lang-Puchhof/Karl August Schmieder die ersten wertvollen Zuchtrennen. Schon 1900 gelingt den beiden mit „Hagen“ der große Wurf: Der Sieg im Deutschen Derby in Hamburg-Horn15!

Carl von Lang-Puchhof und Karl August Schmieder auf der Rennbahn in Frankfurt, 1902
Es folgen mehrere Zuchtrennerfolge mit den in Puchhof gemeinsam gezüchteten Pferden. Die Besitzergemeinschaft ist sehr erfolgreich, 118 Siege und ein Preisgeld von fast 1,2 Mio. RM erlaufen die Pferde mit dem hellblauen Dress und der weißen Kappe7. Karl August Schmieder kommt in dieser Zeit mehrfach nach Puchhof, besucht seine Pferde und lernt dabei seine spätere Frau Mary von Lang-Puchhof (1885-1971) kennen. In den 1902 beginnenden privaten Alben von Mary von Lang-Puchhof erscheinen im Juli 1902 die ersten Bilder auf denen auch „Herr August Schmieder“, wie Mary von Lang-Puchhof selbst die Bilder beschriftet, zu sehen ist.
1901 Kauf von Schlossgut Steinach
Carl von Lang-Puchhof „überredet“ Karl August Schmieder sich auch in der Nähe zu begütern, um auch Pferde züchten und auf die Jagd gehen zu können. Schon 1900 kann Karl August Schmieder Gut Fruhstorf bei Amselfing kaufen, tauscht dieses mit den Gebrüdern Richard und Josef Rabl aus Münchshöfen noch im gleichen Jahr gegen ein Aufgeld von 70 000 Goldmark8 gegen das Gut Einhausen bei Rinkam. 1901 erwirbt er von seinem „Pferdefreund“ und späteren Schwiegervater Carl von Lang-Puchhof zum einen Gut Rinkam (heute Saatzucht Firlbeck)9 und zum anderen das Schlossgut Steinach mit damals rund 485 ha2. Beide Besitzungen hatte Carl von Lang-Puchhof selbst erst 1899 (Steinach von den Freiherrn Berchem-Königsfeld)2 bzw. 1900 (Rinkam von August Kuchenmeister) erworben9.
1902 Erhebung in den Adelsstand
Im Jahr nach Erwerb von Schlossgut Steinach wird Dr. Karl August Schmieder, der zu den reichsten Männern in Bayern zählt, laut Adelsbrief vom 25.08.190210 durch Prinzregent Luitpold in den erblichen Adelsstand der Krone Bayerns erhoben.

Wappen der Familie von Schmieder
Original aus dem Adelsdiplom
Beschreibung im Adelsdiplom vom 25.08.1902:
"Im von Blau über Silber schräglinks getheilten Schilde ein goldenbewehrtes Pferd in verwechselten Farben.
Aus dem gekrönten Helme wachsend ein silbern bewehrter und beflügelter feuerspeiender blauer Drache,
die Flügelrippen roth bespitzt u. den Rückenkamm mit rothen Kugeln besetzt.
Die Helmdecken sind blau-silbern."
Renovierung Altes Schloss Steinach
Steinach mit dem alten Schloss von 1549 und dem großen Grund- und vor allem auch Waldbesitz eignet sich hervorragend, um die Pläne vom eigenen herrschaftlichen Besitz mit Schloss, eigenem Gestüt und großer Jagd zu verwirklichen.
1902 -1904 lässt Karl August von Schmieder das „Alte Schloss“ – wie es heute noch heißt – von Grund auf renovieren, mit einer Zentralheizung, „dem Elektrischen“ versehen sowie neu einrichten, um seiner Zukünftigen, die im modernen, erst 1872 erbauten Schloss Puchhof aufgewachsen ist, einen adäquaten Wohnsitz bieten.
1904 Heirat mit Mary von Lang-Puchhof
Am 7.September 1904 findet die Hochzeit von Dr. Karl August von Schmieder und Mary von Lang-Puchhof in der Schlosskapelle zu Puchhof statt.

Das Brautpaar Mary von Lang-Puchhof und Karl August von Schmieder, 1904
Das Brautpaar bezieht das neu renovierte Alte Schloss Steinach und eine Stadtresidenz in der Leopoldstrasse in München. Die Herrschaft wohnt vorrangig im ersten Stock, von wo aus man ebenerdig in den wunderschön abgeschirmten Garten im Süden heraustreten kann.
Im zweiten Stockwerk befinden sich die Gästezimmer und der noch bestehende große Saal an der Südfront. Hier finden die größeren Feierlichkeiten und Empfänge statt. So werden zum Beispiel an Weihnachten die Bediensteten mit ihren Kindern alljährlich in den großen Saal, wo ein hoher, bunt geschmückter Christbaum steht, eingeladen und mit allerlei Nützlichem, wie z.B. Kleidungsstücken beschenkt14.
Bau des „Neuen Schlosses“
Bald stellt sich heraus, dass das „Alte Schloss“ zu klein ist. Denn, wie Joseph Schlicht in seiner Geschichte von Steinach2 so treffend formuliert: „unser altes Schloss Steinach ist eben nur der Bau von 1549 und für die Besitzverhältnisse von 1901 durchwegs ungenügend“.
Also plant Karl August von Schmieder einen großzügigen Anbau nach Norden, für dessen Verwirklichung aber die dort befindliche Schlosskapelle weichen müsste.
Am Bischöflichen Ordinariat in Regensburg findet der (evangelische) Karl August von Schmieder kein Gehör für seinen Vorschlag die Schlosskapelle abzureißen und am nördlichen Ende des Schlossanbaues wieder neu zu errichten. Daraufhin sucht er nach einem günstigen Platz für die Errichtung eines „Neuen Schlosses“. Zuerst fällt die Wahl auf den Helmberg, der ersten Erhöhung am Rande des Donau-Randbruches mit famosem, unverwehrtem Blick hinaus in die Donauebene. Aber nicht der ganze benötigte Grund kann dort erworben werden. Gleich gegenüber, etwas zurückgesetzt liegt der „Singberg“ und der dort ansässige Landwirt Xaver Holmer kann zum Verkauf des gesamten Anwesens gewonnen werden.
Nach den Plänen des berühmten Architekten Gabriel von Seidl, der so bekannte Gebäude wie das Bayerische Nationalmuseum, das Deutsche Museum und das Künstlerhaus am Lenbachhaus in München oder auch Schloss Neubeuern und Schloss Schönau geplant hat, entsteht unter der Bauleitung von Iwan Bartcky 1904 - 1908 am Singberg ein Traumschloss.

Luftbild Neues Schloss Steinach (um 1920)
Um den Bau verwirklichen zu können und um das Neue Schloss auch mit Steinach und der Strasse nach Straubing zu verbinden, läßt Karl August von Schmieder von der „Staatsstrasse“ bei Rotham bis zum Neuen Schloss eine 3,2 km lange neue Strasse bauen2.
Die junge Familie von Karl August von Schmieder erlebt mit ihren drei in München geborenen Kindern Ernestine (1905), Maximilian (1908) und Berta (1916) nach dem Einzug in dieses prachtvolle Schloss einige sicher traumhaft schöne Jahre. Die drei Kinder werden von strengen Privatlehrern erzogen und unterrichtet. Die Sommermonate genießt man im Neuen Schloss Steinach zusammen mit vielen Gästen. Viele langjährige Freunde der Familie wohnen über Jahre hier, darunter auch die berühmte Wagnersängerin der Münchner Hofoper Berta Morena, die zur besten Freundin und ständigen Begleiterin der Schlossherrin wird und im Schloss Steinach mehrfach auftritt. Aus den Photoalben und den Gästebüchern geht hervor, dass auch hochgestellte Personen des Bayerischen Adels in Steinach zu Besuch waren, wie Herzog Luitpold und Prinz Ludwig von Bayern.

Familie von Schmieder auf der "Löwenbank" im Park des Neuen Schlosses (um 1918)
von links: Ernestine, Mary, Karl August, Berta und Max von Schmieder
Im Winter weilt die Familie oft in München, in der Leopoldstrasse bzw. später in der Ohmstrasse.
1907 errichtet Karl August von Schmieder für seinen Besitz in Steinach, Einhausen und Rinkam ein „Fideikommiss“und „Majorat“2, wonach das gesamte Erbe dem ersten männlichen Nachfahren zufällt. 1922 lässt Karl August von Schmieder dieses „Fideikommiss“ durch das Oberlandesgericht München wieder aufheben und teilt seine drei Güter auf seine Kinder auf. Er vermacht seiner Tochter Ernestine Gut Rinkam, seinem Sohn Max Gut Steinach und seiner Tochter Berta Gut Einhausen, allerdings behält er sich bis an sein Lebensende den Niesbrauch und die Verfügung über die Grundstücke vor.
Die Jagdleidenschaft
Karl August von Schmieder ist begeisterter Jäger. Zu seiner Zeit gibt es auch in unserer Gegend Wild in Hülle und Fülle. Zu den Jagdrevieren von Karl August von Schmieder gehören die umliegenden Jagden der Gemeinden Steinach, Münster und Parkstetten, der Straubinger Spitalwald sowie Teile der Gemeindejagden von Saulburg, Bärnzell, Gschwendt, Agendorf und Unterzeitldorn2. Dazu kommt noch die ca. 1000 ha große Eigenjagd, „deren schönster Punkt die Jagdhütte, die im Oberländerstil gebaut ist und einen reizenden Ausblick gewährt hinab auf das Gestüt, in die Waldberge hinein und in die Ebene hinaus“, wie man in Schlichts „Geschichte von Steinach“ nachlesen kann. Der genaue Standort der Jagdhütte ist ungeklärt, der Beschreibung des Ausblickes nach muss die Jagdhütte wohl am Hang zwischen Gestüt und Dexenhof gelegen haben. Beim Tennisspielen im Neuen Schloss wird Karl August von Schmieder so unglücklich von einem herab fallenden Tennisball eines Mitspielers getroffen, dass er sein rechtes Auge verliert und von da an mit sog. „gekröpften“ Gewehrschäften schießen muss. Interessant aus heutiger Sicht sind die damals vorkommenden Wildarten, die ebenfalls von Schlicht erwähnt werden2. Neben den noch heute häufigen Feldhasen, Rehen und Fasanen gibt es im Steinacher Moos noch große Mengen an Birkwild und am Dexenhof sogar noch Auerwild. Max von Schmieder berichtet mir einmal, dass er in den 20er Jahren öfters mit der Flinte ins Steinacher Moos geschickt wird, um Birkwild für die Küche zu erlegen.

Karl August und Max von Schmieder auf der Jagd
Die weiteren Baumaßnahmen
Der Bau des „Neuen Schlosses“ ist sicher die größte Baumaßnahme die Karl August von Schmieder in Steinach durchführt, aber in den Anfangsjahren seines Besitztums überschlagen sich seine Aktivitäten. An allen Ecken und Enden des neuen Besitzes in Steinach wird gebaut und der Grundbesitz erheblich von ehemals erworbenen ca. 485 ha auf ca. 910 ha erweitert.
Vor allem im Norden von Steinach in Richtung Falkenfels, wo die schweren Urgesteinsverwitterungsböden des Falkensteiner Vorwaldes anstehen, die ohne aufwändige Melioration nicht leicht zu bewirtschaften sind, kann Karl August von Schmieder viele Wald- und Feldgrundstücke von kleineren Landwirten erwerben. Auch südlich von Steinach, zwischen dem Oberen und dem Unteren Harthof erwirbt Karl August von Schmieder ca. 65 Hektar leichten, sandigen Bodens, den er Großteils aufforstet, vorwiegend nach jagdlichen Gesichtspunkten gestaltet und mit vielen Waldecken, kleinen Wildwiesen und Wildäckern dazwischen sowie einer großen Fasanerie zur Aufzucht von Jagdfasanen versieht. Leider wurde dieser Auenwald in den vergangenen 30 Jahren schonungslos ausgekiest.
Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg und der Verlust eines Großteils des Vermögens
Nach dem verlorenen 1.Weltkrieg werden auch für Karl August von Schmieder die Zeiten härter. Einen beträchtlichen Teil seines großen Geldvermögens hat er in Auslandspapieren angelegt. Im Versailler Vertrag von 1919 konfiszieren die Siegermächte die in ihrem Herrschaftsbereich liegenden deutschen Vermögen weitgehend. Nach diesem Desaster nimmt sich der mit der Anlage des Vermögens von Karl August von Schmieder Beauftragte das Leben10,11. Die Inflation 1922 verringert das inländische Vermögen erheblich und durch die Weltwirtschaftskrise von 1928 verliert Karl August von Schmieder nochmals viel an Liquidität.
Seinen 60. Geburtstag feiert Karl August von Schmieder am 29.05.1927 zwar noch im Neuen Schloss, aber bald danach müssen Sparmaßnahmen getroffen werden. Ein Teil des Neuen Schlosses wird stillgelegt, die Gewächshäuser werden nicht mehr beheizt.
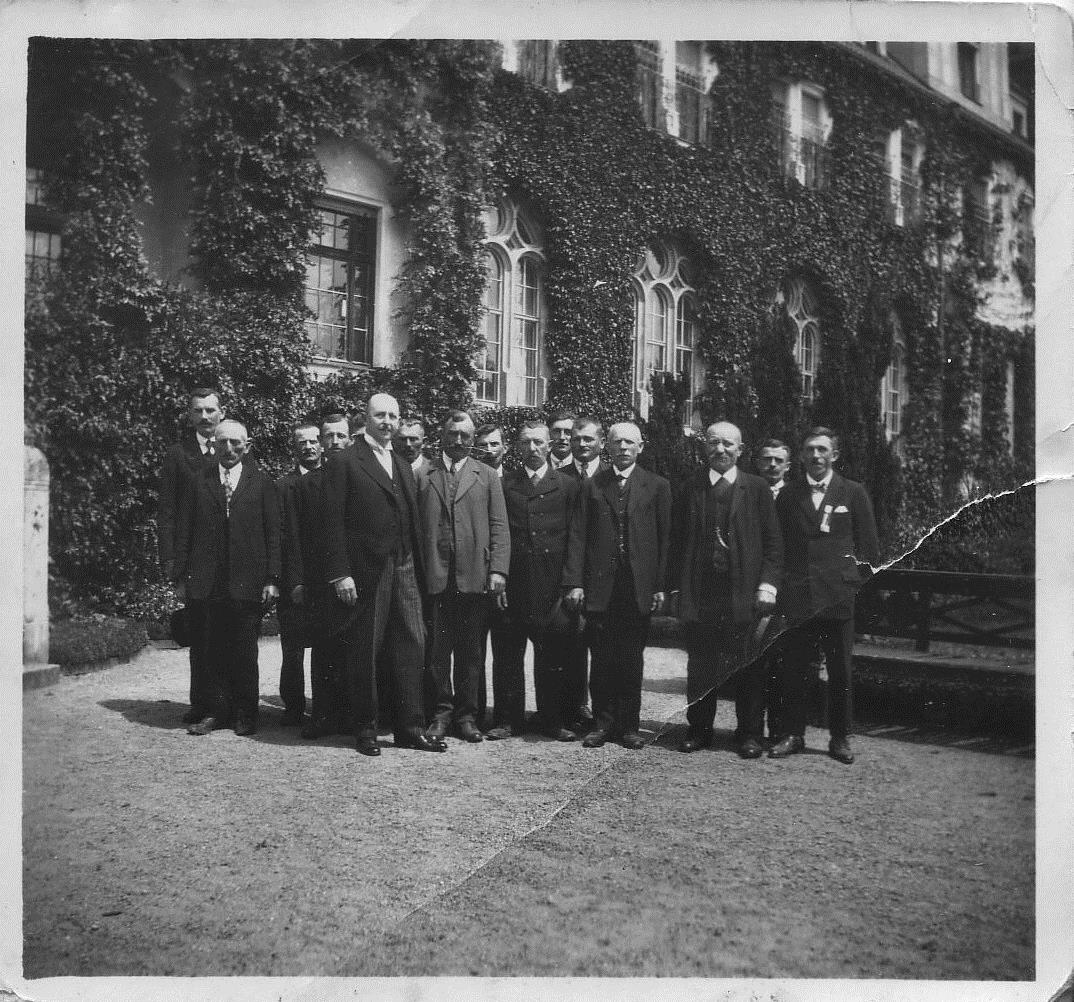
60. Geburtstag von Dr. Karl August von Schmieder im Neuen Schloss 29.05.1927, Besuch durch die Steinacher Honoratioren
von links: Ignaz Fellinger, Josef Hartinger, Xaver Gerstl, Xaver Simmel, Karl August von Schmieder, Xaver Retzer, Josef Hilmer, Josef Beck, ?, Josef Holmer, Xaver Bachl, Bürgermeister Eduard Hagenauer, Simon Bugl, Karl Echinger, Karl Ertl
Es ist nicht genau bekannt, wann Karl August von Schmieder mit seiner Familie das Neue Schloss ganz verlässt. In den Alben von Mary von Schmieder finden sich noch Bilder aus dem Neuen Schloss bis zum Jahr 1930. Danach wohnt die Familie vorwiegend in der Wohnung in der Ohmstrasse in München10.
Mit Kaufvertrag vom 8.2.1934 veräußert Karl August von Schmieder seinen gesamten Waldbesitz von über 600 ha an den Wittelsbacher Ausgleichsfond19.
Die Tochter Ernestine heiratet 1935 den bekannten Münchner Jagd- und Tiermaler Adalbert Meckel und zieht nach München.
Karl August von Schmieder kehrt zusammen mit der jungen Familie seines Sohnes Max erst 1937 zurück nach Steinach ins Alte Schloss. Mary von Schmieder bleibt in München wohnen und zieht später mit ihrer Freundin Berta Morena nach Rottach-Egern, wo sie im Alter von 86 Jahren am 14.11.1971 verstirbt, dort findet sie auch ihre letzte Ruhestätte.
1939 verkauft Karl August von Schmieder das Neue Schloss und den Park mit den übrigen Gebäuden für 440 000 RM an die Reichsautobahn18. Für die geplante, aber im Dritten Reich nie zur Ausführung gelangte Autobahn Nürnberg – Wien soll im Neuen Schloss ein großes Nobelrasthaus mit Hotel errichtet werden. Im Kutschenstall des Neuen Schlosses wird ein großes Arbeitsdienstlager eingerichtet, im Park werden mehreren Holzbaracken errichtet. Von dort werden umfangreiche Arbeiten zur Trockenlegung des Steinacher Mooses und zur Eindeichung der Donau vorgenommen.
Plötzlich und unerwartet verstirbt Karl August von Schmieder am 6. März 1941 in Steinach.
Das Erbe in Steinach tritt sein Sohn Max an.
Bilder:
Liane von Schmieder, Meisham
Carlmax von Schmieder, Dublin
Alben von Mary von Schmieder, Hubertus Meckel, München
Danksagung:
Diesen Artikel zu schreiben war nur durch die bereitwillige Hilfe und Unterstützung mehrerer Personen möglich. Ich möchte mich dafür ganz besonders herzlich bedanken bei:
Liane von Schmieder, Carlmax von Schmieder, Hubertus Meckel und Christine Behmenburg für das Überlassen der vielen Bilder, Dokumente und Informationen
Traudl Niggl, Katharina Firlbeck, den Fellinger Schwestern, Herrn Hans Kirmer, Frau Theresia Zollner für die informativen Gespräche.
Anmerkung und Bitte:
Alle, die diesen Artikel lesen, möchte ich bitten, mir eventuell enthaltene geschichtliche Fehler mitzuteilen und mir vor allem weitere, ergänzende Informationen und Dokumente oder auch Bilder aus der Zeit der Familie von Schmieder in Steinach zur Verfügung zu stellen oder zugänglich zu machen.
Quellen:
- Karlsruher Zeitung 19.4.1951
- Joseph Schlicht, 1908 : Die Geschichte von Steinach
- Dankurkunde der Belegschaft der Schlesischen Aktiengesellschaft für Bergbau an August Schmieder, 1872
- Stadt Karlsruhe, 1981: Schrift zur Eröffnung der Jugendbibliothek , der städtischen Galerie und der Stadtgeschichte im Prinz Max Palais
- Adelsprädikat Dr. jur. Karl und Hermann von Lang-Puchhof, 1.2.1885
- Willi Grünberg, 1958: Geschichte des Schlossgutes Puchhof
- Sportzeitung München, 1916
- Herrmann Rabl, Fruhstorf, 2005: Mündliche Mitteilung
- Michael Wellenhofer, 1994:Hofgeschichte des Firlbeckhofes in Rinkam
- Carlmax von Schmieder, 2005: Mündliche Mitteilung
- Liane von Schmieder, 2005: Mündliche Mitteilung
- N.N. „Schlossgut Steinach“, ohne Jahresangabe
- Ludwig Niggl, 1953: Geschichte der deutschen Grünlandbewegung 1914-45
- Traudl Niggl, Steinach2005: Mündliche Mitteilung
- Direktorium für Vollblutzucht und –rennen, 1994: Sieger bedeutender Zuchtrennen
- Katharina Firlbeck, Rinkam 2005: Mündliche Mitteilung
Dr. Wilhelm Matthießen
(1891 - 1965)
Ein rheinischer Schriftsteller in Steinach
Der Rheinländer Wilhelm Matthießen kam während des Zweiten Weltkriegs mit seiner Frau Carola nach Steinach und blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1965. Mehr als zwanzig Jahre lebte er hier, wichtige Werke entstanden, die Steinacher kannten und schätzten ihn. Auch seine Frau lebte und starb in Steinach. Sie liegt neben ihm auf dem hiesigen Friedhof begraben. Woher aber kam Wilhelm Matthießen, welches waren seine Werke, worin liegt seine Bedeutung?
Geboren wurde Matthießen am 8.8.1891 als Sohn eines Rechtsrates in dem kleinen Eifelort Gemünd. Die Versetzung seines Vaters nach Düsseldorf brachte den Besuch des dortigen Gymnasiums mit sich. Studiert hat Matthießen in Bonn und Berlin Theologie, Philosophie, Geschichte und Germanistik. 1917 promovierte er in Bonn mit der Dissertation „Die Form des religiösen Verhaltens bei Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus“ zum Doktor der Philosophie. Schon während seiner Gymnasialzeit hatte Matthießen viel beachtete Gedichte und Erzählungen, aber auch die Übertragung der Hymnen des Kanonikers und Lyrikers Adam de Saint Victor (gestorben 1146 in Paris) veröffentlicht. Nach seiner Promotion zog er mit seiner Frau Carola nach München und lebte dort bis 1924 als freiberuflicher Wissenschaftler und Schriftsteller. In den Münchner Jahren, in der Atmospäre der damals so blühenden und vielgesichtigen Kunstszene, entstand ungeachtet anfänglicher materieller Sorgen ein umfangreiches wissenschaftliches und literarisches Werk.

Dr. Wilhelm Matthießen (1891-1965)
In rascher Folge gab Matthießen mehrere Schriften des Arztes, Philosophen und Theologen Theophrast von Hohenheim (1493-1541) im Rahmen einer Gesamtausgabe heraus. Es folgten die derbe Sittengeschichte „Grobianus“ von Friedrich Dedekind (1525-1598), die Fabeln von Erasmus Alberus (1500-1563), der seine Gleichnisse als propagandistisches Mittel in der Reformation gegen die katholische Seite benutzte sowie „Das wunderbarliche Vogelnest“ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622-1676), dem Autor des Simplizius-Simplizissimus-Romans.
In den Münchner Jahren entstand auch ein Zyklus von phantastisch-grotesken Geschichten, in denen ein seltsamer Detektiv philosophische und religiöse Probleme zu lösen hatte. Genannt seien der „Der große Pan“, „Der schwarze Hund“ und „Die Sintflut“. Selbst sagte der Autor über seine Grotesken: „Es ging mir weniger um den Tod als um das Leben, zwar nicht um das persönliche, sondern um die Ewigkeit und Unzerstörbarkeit des Seins an sich, das sich bei allem Wandel der Gestalt immer wieder aus sich erneuert - ... Das Thema Gott.“
1926 verfasste er „Das Totenbuch“, eine Sammlung geheimnisvoller Geschichten, die die Bedeutung und das Rätsel des Todes ergründen und ihm seinen Schrecken nehmen: „Tod und Traum, wir grüßen Dich, der Seligen Leben ihr.“ Erst im Tod wird das Geheimnis der „verhüllten Gottheit enthüllt.“ Während das Individuum in den „lachenden Himmel“ eingeht, „ist und lebt alles, was einer mit der ganzen Kraft seines Herzens schuf“.
Berühmt wurde Matthießen durch seine Jugend - und Kinderbücher. 1923 schrieb er „Das alte Haus“, ein Märchenbuch für die Jugend. In bewusster Schlichtheit der Sprache entstand ein Buch, das vom ersten bis zum letzten Satz vorzulesen und ausschließlich für die Jugend bestimmt war, im Gegensatz zu den Märchen der Brüder Grimm, die nicht von vornherein zur Kinderunterhaltung gedacht waren. „Das alte Haus“ stellt einen Märchenzyklus dar, der durch eine jahreszeitlich unterlegte Rahmengeschichte verbunden ist. Es wird keine mahnende Pädagogik vermittelt, trotzdem gelingt es dem Autor, über die Märchenhandlung Verhaltensmuster für das Kind zu schaffen: sei es im Sozialverhalten oder durch Beispielsgeschichten, die die Chance des Schwachen aufzeigen, mit Intelligenz dem Stärkeren widerstehen zu können. Gefahren werden nicht verharmlost, sondern bedrohen die Figuren, die jedoch aufgrund ihrer Gewitztheit, ihres Muts und ihrer „Menschlichkeit“ unter positiver Fügung des Schicksals allen Anfechtungen trotzen können.
Neue Kinderbücher entstanden: „Die grüne Schule“ (1929) und „Die Katzenburg“ (1928). Letzteres fußte auf den familiären Erlebnissen des Dichters, der 1924 von München wieder in das Rheinland gezogen war und dort im Kottenforst bei Bonn in einem Waldhäuschen mit seiner Familie lebte – mittlerweile waren seine Söhne Helmut und Paul geboren.
1928 schrieb Matthießen den umfangreichen historischen Roman „Görres“ über den katholischen, in Koblenz geborenen Publizisten, Gymnasial- und Universitätslehrer.
Matthießen schildert hier das Leben von Joseph Görres (1776-1848), der anfangs begeistert für die Ideen der Französischen Revolution und die Eingliederung des linken Rheinufers in Frankreich eintrat, sich dann jedoch, nach einer Zusammenkunft mit Napoleon, enttäuscht vom revolutionären Gedankengut abwandte und sich als Physiklehrer in Koblenz verdingte. Von Ludwig I. von Bayern wurde Görres schließlich an die Universität in München berufen. Im Mittelpunkt des Romans aber steht die Rückkehr Görres’ zum Katholizismus.
Aufsehen erregte im selben Jahr der in der Kölnischen Volkszeitung veröffentlichte satirische Roman „Die Badewanne“. Anhand eines grotesk überzeichneten Familienstreites, der sich über einer nur scheinbar beschädigten, verliehenen Zinkbadewanne entzündet, zeigt Matthießen die Schwächen des Spießbürgertums der Weimarer Republik auf. Selbstgefälligkeit, Intoleranz und Angeberei werden ebenso angeprangert wie die gesellschaftliche Reaktion auf den Familienstreit, die durch die Massenmedien unterstützte Sensationsgier und die Suche nach Idolen. Der große Erfolg bei den Lesern ließ bei der Ufa den Plan entstehen, den Roman zu verfilmen. Dass die seit 1933 regierenden Nationalsozialisten den Angriff auf ihre vom Kleinbürgertum geprägte Vorstellungswelt ebenso wenig wie irgendeine andere Kritik duldeten, bewirkte das Scheitern dieser Pläne.
So verlagerte sich Matthießens Schreibtätigkeit nun stärker auf die Jugendbuchliteratur, zumal ihm 1932 mit dem Jugendroman „Das rote U“ der größte Erfolg gelungen war. Darin entlarvt unter der anonymen Führung ihres behinderten Klassenkameraden Ulrich eine Schülergruppe eine Verbrecherbande. Neben dem Abbau von Vorurteilen, der Integration von Behinderten und der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten geht es in dem Buch auch um eine spannende Geschichte, die der Erfahrungswelt der Jugend trotz Kriminalhandlung nicht zuwiderläuft. Glaubwürdigkeit verleiht dem Buch zudem der Umstand, dass der Autor Erlebnisse aus seiner Düsseldorfer Gymnasialzeit darin verarbeitet hat.
Während des Nationalsozialismus konnte Matthießen fast nur noch Jugendbücher veröffentlichen. So nahm er während des 2. Weltkriegs die Stelle eines Bibliothekars in München an, eine Tätigkeit, die ihn nach Steinach führte, wo er im Neuen Schloß ausgelagerte Bücherbestände zu verwalten hatte.
Nach 1945 galt die Arbeit des Schriftstellers zum einen der Umarbeitung seiner früheren Jugendbücher, zum anderen der Fortführung seines literarischen Gesamtwerkes. Er verfasste eine über 1000-seitige Gesellschaftsutopie sowie einen umfangreichen Familienroman. Daneben hielt Matthießen Vorträge, schrieb eine Fortsetzung zu „Das alte Haus“ und Hörspiele. Für einen Verlag arbeitete er zeitweise als Lektor. Der Tod seiner Frau Carola im Jahr 1952 traf ihn sehr. Auch machte ihm sein Gesundheitszustand zunehmend zu schaffen. In den letzten Lebensjahren war seine Gehfähigkeit eingeschränkt. Dies bremste seinen Arbeitseifer nicht. Häufig empfing der Autor Besuche von Schriftstellern, Bekannten und Literaturfreunden. Der groß gewachsene Mann verstand es mit seinem Intellekt, seiner Ruhe und seiner packenden Erzählweise die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Bis zum Schluss war er bemüht, sein Lebenswerk abzurunden und die großen Prosawerke abzuschließen. Beides war ihm noch vergönnt, bevor er am 11. November 1965 im Krankenhaus Bogen starb.
Über eine Million verkaufter Exemplare und Übersetzungen seiner Bücher, darunter ins Französische, Englische, Spanische und Japanische, zeigen, dass sein Werk (vor allem: Das Rote U, Das alte Haus, Die grüne Schule, Das Mondschiff) nicht nur im deutschsprachigen Raum gern gelesen wurde und auch heute noch seine Anhänger findet.
Verfasser: Dr. Wilhelm Matthiessen, Enkel des Schriftstellers.
Der oben stehende Text wurde erstmals in Hans Agsteiners Heimatbuch „Steinach“ (1996) veröffentlicht und im Januar 2023 überarbeitet.